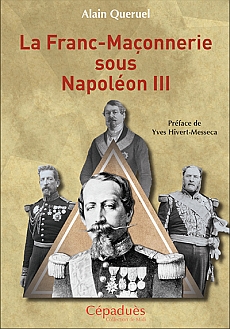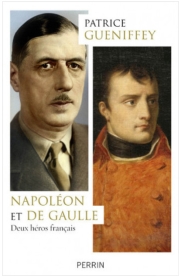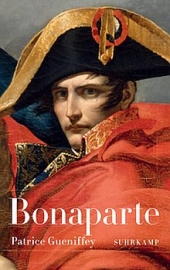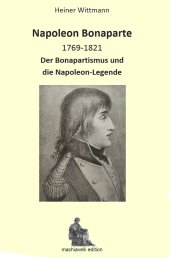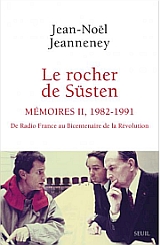
Dans le deuxième tome de ses mémoires, >
Le rocher de Süsten, Jean-Noël Jeanneney raconte les années 1982-1991, durant lesquelles il a été président de Radio France, puis commissaire chargé par le président François Mitterrand pour organiser et de mener à bien les célébrations officielles nationales du Bicentenaire de la Révolution française. Ce volume se termine par sa nomination en tant que secrétaire d’État au commerce extérieur dans le cabinet d’Édith Cresson.
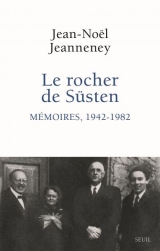 La tâche la plus importante de Jean-Noël Jeanneney au début de son mandat de président de Radio France – sous sa responsabilité se trouvaient entre autres France Inter, France Culture et France Musique comme Radio France Internationale RFI comme par exemple aussi la création de Sorbonne Radio en 1984 – de septembre 1982 à décembre 1986 était son effort de consolider sa position dans la „Maison ronde“ – que de Gaulle avait inaugurée le 14 décembre 1963 – et vis-à-vis de la Haute Autorité (1982-1986) (entre autres p. 52 s. et passim).
La tâche la plus importante de Jean-Noël Jeanneney au début de son mandat de président de Radio France – sous sa responsabilité se trouvaient entre autres France Inter, France Culture et France Musique comme Radio France Internationale RFI comme par exemple aussi la création de Sorbonne Radio en 1984 – de septembre 1982 à décembre 1986 était son effort de consolider sa position dans la „Maison ronde“ – que de Gaulle avait inaugurée le 14 décembre 1963 – et vis-à-vis de la Haute Autorité (1982-1986) (entre autres p. 52 s. et passim).
Dans ses échanges avec les ministres, en particulier avec Georges Fillioud, le ministre de la Communication, il a toujours veillé à l’indépendance de la radio (en particulier au chapitre 2 „Indépendant à tous risques“ p. 45-79) et offre ainsi au lecteur un aperçu important des relations entre la politique et les médias. A la fin de son mandat, le président Mitterrand lui rappela qu’il ne l’avait jamais contacté en tant que président de Radio France (cf. p. 200), ah,  si certains ministres l’avaient fait, cela ne comptait pas, le président essayait de repousser toute tentative d’influence. En effet, Jeanneney ne connaissait que trop bien „les relations politiques incestueuses“ (p. 25) entre la radio et les cabinets successifs, notamment sous la IVe République. Sa volonté de consolider l’indépendance de Radio France passe aussi par le développement des radios locales, qu’il mène avec une grande énergie.
si certains ministres l’avaient fait, cela ne comptait pas, le président essayait de repousser toute tentative d’influence. En effet, Jeanneney ne connaissait que trop bien „les relations politiques incestueuses“ (p. 25) entre la radio et les cabinets successifs, notamment sous la IVe République. Sa volonté de consolider l’indépendance de Radio France passe aussi par le développement des radios locales, qu’il mène avec une grande énergie.
L’auteur du „Rocher de Sud“ fait état d’un très grand nombre de confidents dans son entourage médiatique et politique. Il n’est pas exclu qu’il y ait eu aussi un certain nombre de contradicteurs des deux côtés, surtout après le début de la cohabitation, lorsque Jacques Chirac a été nommé Premier ministre en 1986 et que le président socialiste Mitterrand a dû s’arranger avec une majorité de droite à l’Assemblée nationale. Les désaccords avec les ministres ont pris et prendront finalement la forme d’un échec de Jeanneney à mener à terme son deuxième mandat de président de Radio France. Toutes les querelles, et surtout ses efforts pas toujours couronnés de succès pour repousser l’influence des membres du gouvernement, Jeanneney les note toujours sous le mot-clé „Comédie humaine“, ce qui ne doit en aucun cas être compris comme péjoratif, mais plutôt comme le résultat de son attention et de sa sensibilité envers les relations humaines. Ce sont justement les récits de sa propre position vis-à-vis de ses subordonnés, de ses collaborateurs à son niveau et de ses liens avec le monde de la politique, la manière dont il résolvait les crises ou savait calmer toute sorte de susceptibilités politiques, qui rendent la lecture de ce livre si passionnante.
En ce qui concerne Radio France Internationale (p. 103-122), l’écheveau des relations se complique encore. Hervé Bourges était son directeur, avec lequel Jeanneney s’entend bien, et lorsque Bourges rédige ses mémoires, il a manifestement tout simplement oublié l’organigramme de Radio France et Jeanneney se sent gommé, comme on gommait en URSS les hommes politiques qui déplaisaient sur les photographies. Fouad Benhalla lui succède, avec lequel Jeanneneny n’a pas plus de chance. Ces épisodes de changements de directeurs montrent à quel point le sectarisme politique peut mettre du sable dans les rouages d’une entreprise comme Radio France et comment son président doit s’assurer de la loyauté de ses collaborateurs, y compris de leur indépendance vis-à-vis du monde politique.
Après son départ de Radio France (Ch. 7 Au revoir et merci, p. 187-211) – le président Mitterrand lui avait assuré lors d’un déjeuner à l’Élysée qu’ils se verraient désormais plus souvent sans que l’indépendance de Jeanneney n’en souffre – une nouvelle tâche l’attendait. La mort soudaine d’Edgar Faure le 30 mars 1988, chargé par le Premier ministre Jacques Chirac d’organiser les commémorations du bicentenaire de la Révolution française (= le Bicentenaire), laissa un poste vacant et la réélection de François Mitterrand ouvrit la voie à la nomination de Jeanneney au poste de commissaire aux commémorations du Bicentenaire.
Une tâche immense, une sorte de commando (p. 227) : “ La Mission serait conduite à rappeler sans se laisser aller tout ce qui justifiait les combats des révolutionnaires de jadis et, en opposition aux temps antérieurs, les fidélités des citoyens d’aujourd’hui. “ (p. 320). Des phrases comme celles-ci indiquent la diversité des tâches du commissaire : il ne s’agit effectivement pas de transmettre une historiographie officielle, même s’il a fallu faire un choix parmi les manifestations proposées qui ont reçu le label officiel. D’une part, des raisons financières ont été déterminantes, d’autre part, l’auteur a essayé de souligner l’importance de la Révolution française pour le présent. Et comme pour ses précédents postes, Jeanneney a dû s’opposer à une influence politique, voire à une récupération, ce qui ne signifie rien d’autre que son combat contre une interprétation politiquement marquée, voire une récupération de la Révolution française au profit de la politique officielle, c’est-à-dire aussi d’une politique de parti. Lorsque Jacques Lang devint ministre de la Culture et reçut en plus le titre de ministre du Bicentenaire, dans la douche, le savon échappe à Jeanneney. (cf. p. 235 et suivantes) Mais l’entourage immédiat du président Mitterrand et celui du Premier ministre Michel Rocard confirmèrent au commissaire qu’il avait toujours les mains libres.
Les nombreux déplacements à l’occasion du Bicentenaire étaient également nécessaires pour associer la province aux commémorations. La querelle entre François Furet, qui insistait sur le fait que la Révolution était terminée (cf. p. 255 et suivantes), et Michel Vovelle, qui défendait le point de vue contraire, montre comment le commissaire a lui aussi joué les médiateurs entre les camps, sans pouvoir mettre fin à la querelle. Ce désaccord n’est ici qu’un exemple parmi tant d’autres, par lesquels l’auteur présente dans son autobiographie la confrontation de nombreuses interprétations différentes, non seulement du Bicentenaire en tant que tel, mais aussi de nombreux événements particuliers de la Révolution française, rendant ainsi son livre extrêmement intéressant à lire pour les lecteurs allemands. Comment l’histoire se forme-t-elle et comment est-elle interprétée ? L’intérêt tout occidental de Jeanneney se porte sur „le rôle de la contingence en histoire et de son dialogue avec la liberté des acteurs“. (p. 403) Cela ne vaut pas seulement pour le Bicentenaire, mais aussi pour sa propre biographie, comme ce livre le prouve.
Si l’on énumère les réformes politiques que la Convention a réalisées, il suffit de lire Quatre-vingt-treize de Victor Hugo (cf. p. 264). Il en va de même pour la Terreur, pour laquelle Jeanneney propose également à nouveau l’interprétation de Hugo. (S. 265). Une preuve claire du lien si étroit et fascinant entre littérature, politique et histoire en France.
Une fois de plus, Jeanneney est sensible à la couverture médiatique des quotidiens qui, à Paris notamment, ne semblent pas bien disposés à l’égard de l’organisation du Bicentenaire. Mitterrand lui-même rassure le commissaire. Mitterrand avait fait construire à l’époque un grand réservoir d’eau à Château-Chinon, tout le monde était contre, quand il a été terminé, plus personne n’en a parlé. Jeanneney parvient également à maîtriser les critiques de la part des politiques, principalement de Jacques Lang. Il ne demandait pas d’instructions au ministre de la Culture, mais lui soumettait toujours des rapports au préalable. Peut-être que ce rapport fait partie des histoires autour de la Comédie humaine que Jeanneney raconte ici avec une grande empathie. Ces relations avec tous les acteurs des médias et de la politique montrent comment Jeanneney réussit à mener le Bicentenaire à bien en évitant tous les écueils jusqu’au défilé grandiose du 14 juillet (chap. 12 Le moment Goude, p. 317-342), grâce auquel il réussit à enthousiasmer définitivement la presse pour son projet. Il a de la chance, après que Jacques Chirac l’ait nommé directeur de la Bibliothèque nationale en 2002, il a pu faire en sorte que le fonds du Bicentenaire soit mis à la disposition des chercheurs de manière bien ordonnée.
Le dernier chapitre, 15. Finir et commencer (p. 391-408), est consacré à la recherche d’une nouvelle mission, jusqu’à ce que Jeanneney entre finalement au gouvernement et soit nommé secrétaire d’État au Commerce extérieur.
Certes, on pourrait penser que l’on est en présence d’un livre franco-français. Une appréciation que ce livre pourrait rencontrer en Allemagne. Mais en réalité, ce volume contient également une histoire politique des années que l’auteur a su raconter de manière si détaillée. Il offre ainsi au lecteur allemand un aperçu des fonctions de la politique française d’une manière qu’un ouvrage purement théorique sur la politique ne peut guère offrir. En ce sens, le présent ouvrage, tout comme le premier, est un complément réussi et extrêmement utile pour tous ceux qui s’intéressent de plus près à l’histoire de la Ve République de notre pays voisin.
Im zweiten Band seiner Memoiren >
Le rocher de Süsten, berichtet Jean-Noël Jeanneney über die Jahre 1982-1991, in denen er als Präsident für Radio France verantwortlich war und danach von Staatspräsident Francois Mitterrand als Kommissar mit der Organisation und Durchführung der offiziellen landesweiten Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution beauftragt worden war. Dieser Band schließt mit seiner Ernennung als Staatssekretär für den Außenhandel im Kabinett Edith Cresson.
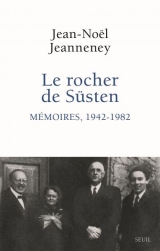 Jean-Noël Jeanneney wichtigste Aufgabe zu Beginn seiner Amtszeit als Präsident von Radio Frankreich – in seiner Verantwortung waren vor allem France Inter, France Culture und France Musique wie Radio France Internationale RFI wie z. B. auch die Gründung von Sorbonne Radio 1984 – von September 1982 bis Dezember 1986 war sein Bemühen, seine Stellung im „Runden Haus“ – das de Gaulle am 14. Dezember 1963 eingeweiht hatte -und gegenüber der Haute Autorité (1982-1986) (u.a. S: 52 f. et passim) zu festigen.
Jean-Noël Jeanneney wichtigste Aufgabe zu Beginn seiner Amtszeit als Präsident von Radio Frankreich – in seiner Verantwortung waren vor allem France Inter, France Culture und France Musique wie Radio France Internationale RFI wie z. B. auch die Gründung von Sorbonne Radio 1984 – von September 1982 bis Dezember 1986 war sein Bemühen, seine Stellung im „Runden Haus“ – das de Gaulle am 14. Dezember 1963 eingeweiht hatte -und gegenüber der Haute Autorité (1982-1986) (u.a. S: 52 f. et passim) zu festigen.
Auch im Austausch mit den Ministern besonders im Austausch mit Georges Fillioud, dem Minister für Kommunikation, achtete er stets auf die Unabhängigkeit des Radios (bes. Kapitel 2 „Indépendant à tous risques“, p. 45-79) und vermittelt auf diese Weise dem Leser wichtige Einblicke in das Verhältnis von Politik und Medien. Nach dem Ende seiner Amtszeit erinnerte ihn der Staatspräsident Mitterrand, daran, dass er ihn als Präsident von Radio France nie kontaktiert habe (vgl. S. 200), ach, sollten es einige Minister getan haben, das zähle nicht, versuchte der Präsident jedweden Versuch einer Einflussnahme abzuwehren. Tatsächlich waren Jeanneney „les relations politiques incestueuses“ (S. 25), so wie sie zischen dem Radio und den  aufeinander folgenden Kabinetten besonders unter der IV. Republik gang und gäbe waren, nur zu gut bekannt. Zu seinem Bestreben nach einer Festigung der Unabhängigkeit von Radio France gehörte auch der Ausbau er Lokalradios, die er mit großer Energie betrieb.
aufeinander folgenden Kabinetten besonders unter der IV. Republik gang und gäbe waren, nur zu gut bekannt. Zu seinem Bestreben nach einer Festigung der Unabhängigkeit von Radio France gehörte auch der Ausbau er Lokalradios, die er mit großer Energie betrieb.
Der Autor des „Rocher de Süsten“ berichtet von einer sehr großen Zahl Vertrauter in seinem Umfeld der Medien wie auch in der Politik. Es bleibt nicht aus, dass es auch auf beiden Seiten eine gewisse Zahl von Widersachern gibt, besonders nach dem Beginn der Kohabitation, als Jacques Chirac 1986 zum Premierminister ernannt wurde und der sozialistische Präsident Mitterrand sich mit einer rechen Mehrheit in der Nationalversammlung arrangieren musste = „une cohabitation“. Die Meinungsverschiedenheiten mit den Ministern nahmen und führen letztendlich dazu, dass Jeanneney sein zweites Mandat als Präsident von Radio Frankreich nicht zu Ende führte. Alle Querelen, vor allem seine nicht immer erfolgreichen Anstrengungen die Einflussnahme der Regierungsmitglieder abzuwehren, notiert Jeanneney immer wieder unter dem Stichwort „Comédie humaine“, was keinesfalls als abwertend verstanden werden darf, sondern eher das Ergebnis seiner Aufmerksamkeit und seiner Sensibilität gegenüber den zwischenmenschlichen Beziehungen zu geschuldet ist. Es sind gerade die Berichte über die eigene Position gegenüber Untergebenen, den Mitarbeitern auf seiner Ebene und die Verbindungen zu Welt der Politik, die Art und Weise, wie er Krisen löste oder jede Art von politischen Empfindlichkeiten zu beruhigen wusste, die die Lektüre dieses Buches so spannend macht.
In Sachen Radio France Internationale (S. 103-122) wird das Beziehungsgeflecht noch komplizierter. Hervé Bourges war sein Direktor, mit dem Jeanneney überhaupt auskommt, und als Bourges seine Memoiren verfasst hat er offensichtlich das Organigramm von Radio France einfach vergessen und Jeannneney fühlt sich ausradiert, so sie wie man in der UdSSR missliebige Politiker auf Photographien wegretuschierte. Fouad Benhalla wurde sein Nachfolger, mit dem Jeanneneny genausowenig Glück hatte. Diese Episoden mit den wechselnden Direktoren zeigt an einem Fallbeispiel, wie sehr politischer Sektarismus Sand in das Getriebe eines Unternehmens wie Radio Frankreich streuen kann und wir sein Präsident sich der Loyalität seiner Mitarbeiter, die Unabhängigkeit gegenüber der Politik inbegriffen versichern muss.
Nach seinem Abschied von Radio France (Ch. 7 Au revoir et merci, p. 187-211) – Präsident Mitterrand hatte ihm bei einem Essen im Élysée-Palast versichert, man werde sich jetzt öfters sehen, ohne dass darunter Jeanneneys Unabhängigkeit leiden müsse, wartete eine neue Aufgabe auf ihn. Der plötzliche Tod von Edgar Faure am 30. März 1988, der im Auftrag von Premierminister Jacques Chirac die Gedenkfeiern zum 200. Jahrestag der französischen Revolution (= le Bicentenire de la Révolution) organisieren sollte, hinterließ einen vakanten Posten und die Wiederwahl von François Mitterand machte den Weg für zur Ernennung Jeanneneys für die Aufgabe als Kommissar für Revolutions-Gedenkfeiern.
Eine Mammutaufgabe, eine Art Commando (p. 227): „La Mission serait conduite à rappeler sans se lasser tout ce qui justifiait les combats des révolutionnaires de jadis et, en opposition aux temps antérieurs, les fidélités des citoyens d’aujourd’hui.“ p. 320). Sätze wie diese weisen auf die vielfältigen Aufgaben des Kommissars hin: Es geht tatsächlich nicht darum, eine offizielle Geschichtsschreibung zu vermitteln, wenn auch eine Auswahl der angebotenen Veranstaltungen die das offizielle Label bekamen, getroffen werden musste. Einerseits waren finanzielle Gründe ausschlaggebend, anderseits auch der Versuch seitens des Autors gerade der Bedeutung der Französischen Revolution für die Gegenwart hervorzuheben. Und wie schon auf seinen letzten Posten musste sich Jeanneneny auch hier wieder gegen politischer Einflussnahme, ja Vereinnahmung widersetzen und damit ist nichts anderes gemeint als sein Kampf gegen eine politisch geprägte Interpretation oder gar eine Vereinnahmung der Französischen Revolution zugunsten der offiziellen Politik, sprich auch einer Parteipolitik. Als Jacques Lang Kulturminister wurde und dann noch den Titel eines Ministers des Bicentenaire erhielt, entglitt Jeanneney die Seife in der Dusche. (vgl. S. 235 f) Aber die unmittelbare Umgebung von Präsident Mitterrand und der der Premierminister Michel Rocard bestätigten dem Kommissar, weiterhin freie Hand zu haben.
Die vielen Reisen anlässlich des Bicentenaire waren auch notwendig, um die Provinz in die Gedenkfeiern einzubinden. Der Streit zwischen François Furet, der darauf bestand, die Revolution sie beendet (vgl. S. 255 ff) und Michel Vovelle, der für die gegenteilige Aussage stand, zeigt, wie auch der Kommissar zwischen den Lagern vermittelte, ohne den Streit beenden zu können. Dieser Dissens ist hier nur ein Beispiel von vielen, mi denen der Autor hier in seiner Autobiographie, das Aufeinandertreffen vieler verschiedener Interpretationsansätze nicht nur bezüglich des Bicentenaires als solchem, sondern auch vieler einzelner Vorgänge während der Französischen Revolution vorträgt und damit sein Buch auch für deutsche Leser so überaus lesenswert macht. Wie entsteht Geschichte und wie wird sie interpretiert: Jeanneneys ganz wesentliches Interesse richtet sich auf die „rôle de la contingence en histoire et de son dialogue avec la liberté des acteurs.“ (S. 403) Das gibt nicht nur in Bezug auf das Bicentenaire sondern auch für seine eigene Biographie, wie dieses Buch beweist.
Zählt man auf, welche politischen Reformen die Convention realisiert hat, man muss nur Quatre-vingt-treize von Victor Hugo lesen (vgl. S. 264). Das gilt auch für die Terreur, für die Jeanneney auch wieder die Interpretation Hugos vorlegt. (S. 265). Ein klarer Belegt für die so enge und faszinierende Verbindung von Literatur, Politik und Geschichte in Frankreich.
Wieder ist Jeanneney sensibel für die Berichterstattung in den Tageszeitungen, die besonders in Paris gegenüber der Organisation des Bicentenaire nicht wohlgesonnen erscheint. Mitterrand selbst beruhigt den Kommissar. Mitterrand habe damals in Château-Chinon ein großes Wasserreservoir bauen lassen, alle seien dagegen gewesen, als es fertig war, habe niemand mehr davon gesprochen. Auch die Kritik seitens der Politik, hauptsächlich von Jacques Lang bekommt Jeanneney in den Griff. Nach Anweisungen des Kulturministers fragte er nicht, sondern legte ihm vorher schon immer Berichte vor. Vielleicht gehört auch dieses Verhältnis zu den Geschichten rund um die Comédie humaine, über die Jeanneney hier mit großem Einfühlungsvermögen berichtet. Diese Verhältnisse zu allen Akteuren in den Medien und in der Politik zeigt wie Jeanneney das Bicentenaire um alle Untiefen erfolgreich herumsteuert bis zur grandiosen Parade am 14. Juli (Kap. 12 Le moment Goude, S. 317-342), mit der es ihm gelingt, endgültig auch die Presse für sein Projekt zu begeistern. Er hat Glück, nachdem Jacques Chirac ihn 2002 zum Direktor der Nationalbibliothek ernannt hatte, konnte er dafür Sorge tragen, dass der Nachlass des Bicentenaire wohlgeordnet Forschern zur Verfügung stand.
Das letzte Kapitel 15. Finir et commencer (S. 391-408) ist der Suche nach einer neuen Aufgabe gewidmet, bis Jeanneney schließlich in die Regierung eintritt und zum Staatssekretär für Außenhandel ernannt wir
Sicher, man könnte meinen, eine franko-französisches Buch vor sich zu haben. Eine Einschätzung, die diesem Buch in Deutschland begegnen könnte. Tatsächlich aber enthält dieser Band auch eine politische Geschichte der Jahre, über die der Autor so detailliert zu berichten weiß. Auch dem deutschen Leser legt er dabei Einblicke in die Funktionen der französischen Politik auf eine Art und Weise offen, wie ein rein theoretisches Lehrwerk über die Politik dies kaum leisten kann. In diesem Sinne ist der vorliegende Band wie auch der 1. Band eine gelungene und äußerst nützliche Ergänzung für alle, die sich mit der Geschichte de V. Republik unseres Nachbarlandes eingehender beschäftigen wollen.
Jean-Noël Jeanneney,
Le Rocher de Süsten, t. 2 1982-1991
De Radio France au Bicentenaire de la Révolution
Paris : > Seuil 2022.
432 pages
EAN 9782021513318
Jean-Noël Jeanneney,
> Le Rocher de Süsten
Mémoires, 1942-1982, > Rezension
Paris : > Seuil 2020.
> Le site personnel de Jean-Noël Jeanneney
Auf unserem Frankreich-Blog:
Jean-Noël Jeanneney, Virus ennemi. Discours de crise, histoire de guerres. Collection Tracts, Série Grand format, Gallimard 2020. – 22. Juni 2020
Nachgefragt:
Jean-Noël Jeanneney, La Grande Guerre, si loin, si proche – 25. Mai 2014
> Darf Google eine Welt-Bibliothek digitaler Bücher aufbauen?
Jean-Noël Jeanneney sorgt sich zur Recht um das kulturelle Erbe Frankreichs – 1. September 2009
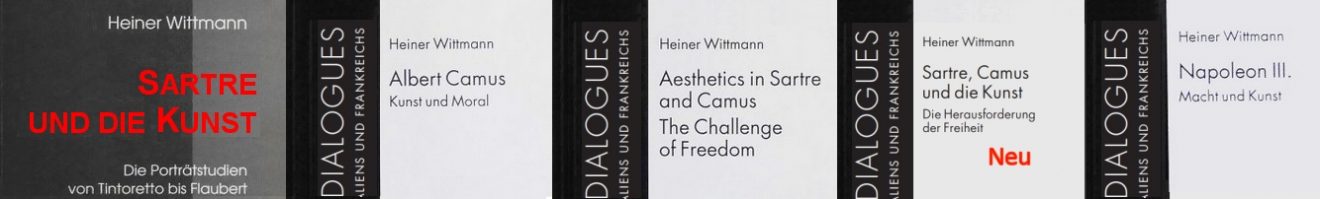


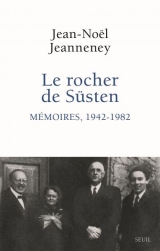
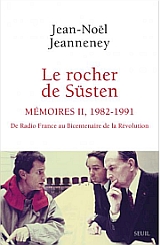

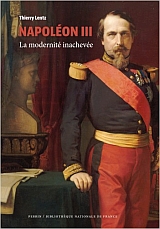


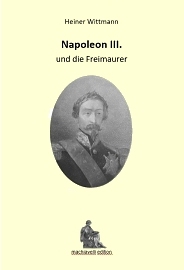
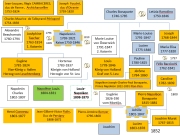

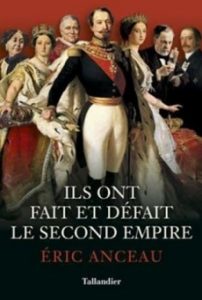 Le livre d’Éric Anceau >
Le livre d’Éric Anceau >