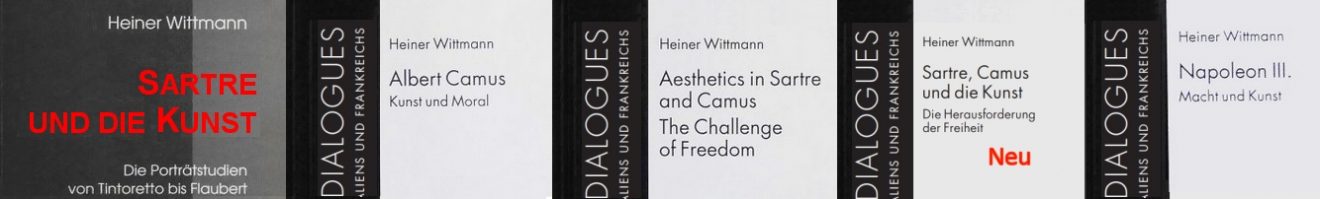Sartre und Tintoretto
Der Künstler verkauft Visionen. Jean-Paul Sartre und Tintoretto
Vortrag. Freitag, 12. 1. 2007, 19 h 30
Institut français, Berlin, Kurfürstendamm 211, U1 Uhlandstraße
Auf Deutsch und Französisch. Der Vortrag wird von Vincent von Wroblewsky gedolmetscht.
Eine Veranstaltung der Sartre-Gesellschaft und des Institut français, Berlin.
„L’artiste, c’est l’ouvrier suprême: il s’épuise et fatigue la matière
pour produire et pour vendre des visions.“
J.-P. Sartre, Le Séquestré de Venise,
in: id. Situations, IV, Paris 1964, S. 319.
Der Maler Jacopo Robusti, genannt Tintoretto (1518-1594), gehört einer ganz anderen Epoche an, als die Künstler, Schriftsteller und Dichter, deren Werke Jean-Paul Sartre in seinen Künstlerstudien untersucht hat. In ihnen hat er ein Verfahren entwickelt, mit der er auch die Gemälde des venezianischen Meisters untersucht.
Es liegen mehrere Fragmente seiner Studie über Tintoretto vor. 1957 wendet er seine psychanalyse existentielle, die er im letzten Kapitel von L’être le néant (1943) beschrieben hat, auf den Künstler an. Im gleichen Jahr verfaßt er den Aufsatz Questions de méthode, in dem der Beitrag der Hilfsdiziplinen (Psychonalyse u.a.) zu seiner progressiv-regressiven Methode erläutert werden. 1961 vergleicht er viele Gemälde Tintorettos untereinander, bevor er 1966 das Bild San Girogio uccide il drago (1558, National Gallery, London) in all seinen Details untersucht. Ein weiteres Fragment erscheint 2005 im Ausstellungs-katalog der Pariser Nationalbibliothek unter dem Titel Un vieillard mystifié (Sartre, éd. M. Berne, Gallimard, Paris 2005, S. 186-190), in dem Sartre das Selbstporträt des Meisters (1585, Louvre, Paris) analysiert. Die Bedeutung der Beziehungen zwischen Theorie und den Künstlerporträts für seine Ästhetik wird mit dem ersten Satz der Flaubert-Studie „L’Idiot de la famille est la suite de Questions de méthode“ ausdrücklich unterstrichen.
Sartre hat mit mehreren, unterschiedlichen Ansätzen die Gemälde Tintorettos untersucht. Dabei wird eine Porträtmethode erkennbar, mit der Sartre Grundsätze seiner Philosophie nutzt, um eine Ästhetik zu formulieren. Wie in seiner Literaturtheorie geht es auch bei Tintoretto um die Mitarbeit des Rezipienten, also hier des Betrachters, den der Maler mittels seiner Maltechnik an der Entstehung des Werks beteiligt. Bei Tintoretto, wie bei den anderen Künstlern, deren Werke Sartre untersucht hat, gehören die Freiheit und die Unabhängigkeit zu den Bedingungen seines Erfolgs.
 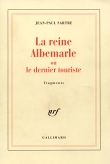 „Après sa première nuit vénitienne, l’animal touristique seréveille amphibie; il constate en même temps qu’il lui a poussé des nageoires et il retrouvé l’usage de ses pieds. Ce matin, je marche, je vais au hasard … suivant des calli, traversant des ponts, débouchant sur des campi, m’égarant, tombant dans un cul de sac, revenant sur mes pas, repassant par les mêmes calli et les même campi sans trop m’en aviser. “ „Après sa première nuit vénitienne, l’animal touristique seréveille amphibie; il constate en même temps qu’il lui a poussé des nageoires et il retrouvé l’usage de ses pieds. Ce matin, je marche, je vais au hasard … suivant des calli, traversant des ponts, débouchant sur des campi, m’égarant, tombant dans un cul de sac, revenant sur mes pas, repassant par les mêmes calli et les même campi sans trop m’en aviser. “J.-P. Sartre, La Reine Albemarle ou le dernier touriste, fragments, éd. A. Elkaïm-Sartre, Paris 1991, S. 84. |
 „A Venise, les Vénetiens sont chez eux. Et il suffit d’un ciel un peu doux, comme ce matin, d’une lumière un peu tendre, gaie come un sourire, pour que le touriste se sente un peu moins touriste, presque vénetien.“ Sartre, op. cit., S. 86 „A Venise, les Vénetiens sont chez eux. Et il suffit d’un ciel un peu doux, comme ce matin, d’une lumière un peu tendre, gaie come un sourire, pour que le touriste se sente un peu moins touriste, presque vénetien.“ Sartre, op. cit., S. 86 |
 „Au bout d’un certain temps, ce qui m’inquiète c’est presque moral : à moins de monter sur le Campanile de Saint-Marc, Venise est une ville qui se dérobe à toute vue d’ensemble. Elle fuit, vous contraint à vous prendre dans le détail…“ Sartre, op. cit., S. 106 „Au bout d’un certain temps, ce qui m’inquiète c’est presque moral : à moins de monter sur le Campanile de Saint-Marc, Venise est une ville qui se dérobe à toute vue d’ensemble. Elle fuit, vous contraint à vous prendre dans le détail…“ Sartre, op. cit., S. 106 |
 „Venise a ses propres coordonnées : la place Saint Marc, la lagune, les Fondamenta Nuova : elle ignore les points cardinaux. Je me trompais, tout à l’heures, en disant qu’elle fabrique ses vitesse : à l’intérieur de Venise il n’y a pas de vitesse du tout.“ Sartre, op. cit., S. 87. „Venise a ses propres coordonnées : la place Saint Marc, la lagune, les Fondamenta Nuova : elle ignore les points cardinaux. Je me trompais, tout à l’heures, en disant qu’elle fabrique ses vitesse : à l’intérieur de Venise il n’y a pas de vitesse du tout.“ Sartre, op. cit., S. 87. |
 „L’humidité dans l’air, au ciel. L’eau. Douce humidité, fraîcheur, fond de l’air tiède. Gondole. La gondole c’est exactement un fiacre.“ Sartre, op. cit.,. S. 80. „L’humidité dans l’air, au ciel. L’eau. Douce humidité, fraîcheur, fond de l’air tiède. Gondole. La gondole c’est exactement un fiacre.“ Sartre, op. cit.,. S. 80. |
 „Les campis ne sont parcurus par aucune ligne,droite ou courbe : ce sont des étendues de pierre stragnante, de marécages de pierre.“ Sartre, op. cit., S. 88 „Les campis ne sont parcurus par aucune ligne,droite ou courbe : ce sont des étendues de pierre stragnante, de marécages de pierre.“ Sartre, op. cit., S. 88 |
 „L’eau à Venise palpite, elle se dilate et se contracte, dit-on, notre univers. Sorti de la gondole, je reste longtemps à regarder une crème verdâtre à la surface du rio, qui tantôt se resserre, tantôt file doucement vers le canal de la Giudecca, tantôt recule et tantôt s’arrête. Sartre, op. cit., 109 „L’eau à Venise palpite, elle se dilate et se contracte, dit-on, notre univers. Sorti de la gondole, je reste longtemps à regarder une crème verdâtre à la surface du rio, qui tantôt se resserre, tantôt file doucement vers le canal de la Giudecca, tantôt recule et tantôt s’arrête. Sartre, op. cit., 109 |
 „Venise est la ville qui protège le moins contre l’espace. Le ciel et l’eau sont complices, ils sont trop. L’eau s’enroule sur elle-même, le ciel a un autre genre de foisonnement, il écarte les regards, il éblouit,distend par des épanouissements mats de lumière.“ Sartre, op. cit., S. 104 „Venise est la ville qui protège le moins contre l’espace. Le ciel et l’eau sont complices, ils sont trop. L’eau s’enroule sur elle-même, le ciel a un autre genre de foisonnement, il écarte les regards, il éblouit,distend par des épanouissements mats de lumière.“ Sartre, op. cit., S. 104 |