


L’impact du numérique sur nos sociétés
Milad Doueihi,
Pour un humanisme numérique
Paris:  Seuil, 2011.
Seuil, 2011.
180 S.
ISBN 978.2.02.100089.4
Ce livre cherche à expliquer l’impact du numérique sur nos sociétés, nos manières de penser et nos valeurs. Milad Doueihi voudrait évaluer l’avenir de la société numérique. Sans aucun doute, le numérique nous accompagne déjà partout. Ce n’est pas seulement le monde du travail, c’est aussi tout autre domaine de la vie sociale, qui en dépend étroitement. On n’exagérerait pas en affirmant que la conversion numérique ne nous laisse plus le choix. Sans états d’âme, Milad Doueihi franchit le pas et applique à la réflexion sur l’avenir de notre civilisation des notions ancrées dans nos traditions humanistes, telles que la poésie, l’amitié ou l’anthologie.
La première page présente sa thèse: „L’humanisme numérique est l’affirmation que la technique actuelle, dans sa dimension globale, est une culture, dans le sens où elle met en place un nouveau contexte, à l’échelle mondiale, et parce que le numérique, malgré une forte composante technique qu’il faut toujours interroger et sans cesse surveiller (car elle est l’agent d’une volonté économique), est devenu une civilisation qui se distingue par la manière dont elle modifie nos regards sur les objets, les relations, les valeurs, et qui se caractérise par les nouvelles perspectives qu’elle introduit dans le champ de l’activité humaine.“ (p. 9 s.) En d’autres termes, M. Doueihi constate que notre compréhension du monde numérique est déjà largement modifiée par le numérique, lequel révèle d’ores et déjà d’un humanisme numérique. L’expression n’est pas sans surprendre le lecteur, car cette combinaison semble admettre une emprise sur toutes nos activités, à laquelle nous ne saurions plus nous soustraire. Il est vrai que les ordinateurs ne nous laissent déjà plus d’issue. Une de leurs défaillances nous expose aux dangers de toutes sortes, comme une simple perte de données appelle des suites plus ou moins graves pour nos activités personnelles. Conscients de cette dépendance, nous hésiterons à associer l’humanisme avec le numérique, car il nous est difficile de soumettre l’humanisme à la technique ou de permettre au monde numérique de définir notre humanisme. Conscients de cette dépendance, nous hésiterons à associer l’humanisme avec le numérique, car il nous est difficile de soumettre l’humanisme à la technique ou de permettre au monde numérique de définir notre humanisme. – Cependant „humanisme numérique“ se réfère davantage aux „digital humanities“ dont il est la traduction littérale: cette expression met l’accent sur l’emploi du numérique dans les sciences sociales et la littérature, sans trancher d’emblée la question de l’enjeu proprement „humaniste“ de cette culture numérique.
Milad Doueihi est convaincu que „la culture du livre et de l’imprimé“ (p. 10) connaît une crise due aux développements et aux pratiques du numérique. Le visiteur des dernières grandes foires des Livres en Allemagne à Francfort et à Leipzig semble contredire M. Doueihi car malgré les avertissements des défenseurs du livre numérique (e-book), ses percées sont à peine sensibles. Et si l’on songe à l’aide qu’Internet fournit à un étudiant qui, en lettres, par exemple, écrit un travail de fin d’études, on remarquera vite que, hormis les banques de données pour les recherches bibliographiques et les bibliothèques en ligne, l’apport est quasiment inexistant. De même que la notion d’ « humanisme numérique » prête à malentendu, l’expression « culture numérique » appelle des réserves : on pourrait préférer parler de l’influence des pratiques numériques sur la culture, sans présenter d’emblée la culture comme numérique.
Sur France-blog:
 Peut-on encore exister sans Internet? Oder kann man ohne das Internet studieren?
Peut-on encore exister sans Internet? Oder kann man ohne das Internet studieren?
 Ecrivez-vous à la main ou tapez-vous au clavier ?
Ecrivez-vous à la main ou tapez-vous au clavier ?
Que d’objections soulevées dès la première page du livre ! Mais reprenons la lecture. Milad Doueihi trouvera certainement une issue pour justifier sa thèse. Son premier chapitre nous propose encore d’autres définitions. Accélération, instantanéité et immédiateté (p. 11) sont pour lui les signes et la preuve que la conversion numérique (p. 12) nous a déjà atteints. Sans appel. M. Doueihi emploie une image: „L’urbanisme virtuel est le site de la culture anthologique naissante, de cette culture à la fois lettrée et populaire, savante et amatrice.“ (S. 17). Il faut concéder une part de vérité à cette affirmation : le désir d’être toujours mobile produit une „culture mobile“, (p. 18), soutenue par le Cloud Computing, favorisant fragmentation et anthologisation du savoir. Ces deux notions sont reconnues par Milad Doueihi qui les analyse sous tous leurs aspects dans deux longs chapitres de son ouvrage. Il ne manque pas de donner une définition au terme qui a succédé aux Humanities Computing : “ Digital Humanities est le terme courant qualifiant les efforts multiples et divers de l’adaptation à la culture numérique du monde savant.“ (p. 22)
Le numérique est une technique dont nous pouvons nous servir, or Milad Doueihi pense avec quelque raison que la technique numérique nous a déjà dépassés. La conversion numérique est notre réalité. Chaque étudiant, même en Lettres ou en philosophie, aura tout intérêt à savoir se servir du numérique pour étudier avec succès et rapidement, pourrait-on en déduire avec quelque raison. Au lieu d’accepter le tout-numérique comme une fatalité envahissante, Milad Doueihi nous inspire le désir de dominer la technique pour aller de l’avant.
La lecture de l’ouvrage de M. Doueihi inspire un bon nombre de réflexions concernant les procédés numériques. Un exemple parmi d’autres. La „numérisation massive de nos archives“ (p. 26) n’est pas sans provoquer un grand nombre de problèmes. La numérisation d’une archive n’est pas forcément un grand avantage car le chercheur s’intéresse souvent à l’état actuel des documents comme l’archéologue souhaite pouvoir faire des recherches sans que les objets in situ aient été modifiés par d’autres personnes. Une numérisation modifie les rapports des documents entre eux et il est difficile de dire si les avantages du numérique prévalent vraiment.
Le fragment numérique, Milad Doueihi en est bien conscient, modifie les modalités de la lecture. D’autres formes d’auteur naissent, des pratiques nouvelles de l’écriture sont mises à la disposition d’un grand nombre. On appelle cela la „démocratisation“ (p. 45). M. Doueihi a raison de mettre ce terme entre guillemets, car la représentation démocratique est mal appropriée pour désigner les activités d’un grand nombre de personnes. Toutefois, la fragmentation modifie aussi les conditions des narrations et des récits. Parlons des possibilités nouvelles, au lieu de ne voir que l’excessive fragmentation apportée par la télévision sous domination de l’Internet. „…la modification de la géographie humaine à l’échelle globale“ et „La fin de la séparation““ (p. 52 s.) conduisent, selon Milad Doueihi, à l’“humanisme numérique“ (p. 54), dont il pense qu’il est notre „culture nouvelle“. (p. 55)
Le long chapitre sur l’amitié évoque la puissance des réseaux sociaux, dont échange et partage sont les nouveaux signes d’un „urbanisme virtuel“ (p. 73). La distance critique de M. Doueihi par rapport à ces réseaux lui permet de reconnaître les failles et les contraintes auxquelles sont soumis les usagers de Facebook, par exemple. L’aspect communautaire, même dans un réseau social, ne fonctionne que dans la mesure où les usagers croient voir l’avantage qu’ils en retirent. Nul n’y reste longtemps engagé sans une contrepartie plus ou moins grande, en termes d’attention ou de réputation, monnaie sociale du Web (p. 98). Cet aspect, M. Doueihi paraît le négliger, même s’il évoque longuement la „Solitude numérique“ (p. 85-91).
Le chapitre sur la culture anthologique (p. 105-138) présente une réflexion sur les rapports entre lecture et écriture. > www.storify.com, > www.readsocialapi.com ou le site > www.qwiki.com sont des offres sur Internet qui permettent de créer des histoires tout en incluant un aspect communautaire. Milad Doueihi a analysé ces sites sous l’angle de la „prolifération“ et de la „segmentation“ (S. 111-118) de l’information. Les trois offres laissent prévoir quelles seront les issues du Web social. L’un des signes majeurs en est sans doute le fonctionnement combinatoire avec des variantes innombrables. De ces pratiques découle „une sociabilité numérique“ (p. 115, 125) qui selon M. Doueihi „…met en place une nouvelle réalité, des conditions de sociabilité qui sont génératrices de nouvelles valeurs.“ (S. 125). -Cette perspective est compréhensible, néanmoins, il faut avouer que > la présence de www.france-blog.info sur Facebook est toute négative : sans une participation très active (au détriment du blog) le nombre des amis sur la page de Facebook n’augmente guère. Et qui a vraiment envie de travailler plus pour Facebook au détriment du blog ? – La fragmentation constatée plus haut, M. Doueihi la constate aussi pour la personnalité dans un réseau social et il reconnaît que les rapports avec „le privé et le confidentiel“ s’y transforment.
Les sites qui rassemblent ou constituent des textes plus ou moins automatiquement valorisent des données librement accessibles en les présentant sous une autre forme. On pourrait se demander si c’est un jeu > www.qwiki.com/q/Jean-Paul_Sartre, or on ne voit pas l’intérêt de combiner techniques, textes et ressources existant déjà sur Internet, alors que ce site représente une étape dans une recherche, visant à mieux satisfaire les attentes de la clientèle Web 2.0. – Mais, il y a une autre face du problème. Qwiki rappelle que tout auteur ou „L’intelligence collective“ abandonne son texte à la collectivité. D’autres sont libres d’y changer des mots et des phrases comme bon leur semble. L’individu disparaît de plus en plus, si la collectivité s’arroge le contrôle des textes. Intelligence collective, dilution des droits individuels, on doit poser la question, riment-ils avec l’humanisme numérique ? Dès qu’un article est mis en ligne sur Wikipédia, les correcteurs apparaissent, forme et contenu sont pêle-mêle soumis aux corrections, souvent, concédons-le, des fautes manifestes disparaissent rapidement. Mais il suffit de > feuilleter les archives de corrections pour voir que les correcteurs malgré leur grand nombre sont lents et que tout le monde se mêle de rédaction.
La construction du sens, la rédaction d’un récit au temps du monde numérique ouvre une époque nouvelle: „La production du contenu n’est plus désormais le privilège des humains.“ (p. 145 du chapitre „Oubli de l’oubli“). On songe peut-être tout de suite aux failles des moteurs de recherche qui nous orientent dans le monde numérique, selon ce que les machines savent de nos préférences. Ou croient savoir. La tentation de nous fournir une bonne publicité l’emporte sur la volonté de nous fournir un bon résultat de recherche. M. Doueihi est conscient du problème que la culture numérique modifie nos rapports à la mémoire et que le numérique contribue à nous suggérer que tout est accessible (cf. p. 152). Et l’oubli? Plus haut, M. Doueihi avait déjà constaté que Facebook rend difficile la suppression définitive d’un compte personnel en abusant de tous les procédés pour faire revenir une personne qui tient à refuser les services de Facebook. Des archives demeurent sur Internet, qui enregistrent les différentes versions de mes sites Internet, sans qu’on m’ait jamais demandé mon autorisation. De plus, Facebook marque et identifie les visages sur les photos affichées sur les comptes de ses participants. Et Google images se permet de collectionner et d’afficher photos et graphiques au mépris des droits. Une fois qu’on a montré une photo sur un site, elle est quasiment ineffaçable, Internet n’oublie rien: „…effacer doit être un droit,“ (p. 154) exige M. Doueihi avec raison.
M. Doueihi y insiste, (cf. p. 163) il ne veut pas parler de „l’effroi technologique“, il préfère rendre compte de „l’imaginaire du numérique“ et se demander comment le numérique „dessine un nouvel espace partagé entre le réel et le virtuel.“ (p. 166) Il est vrai, et on ne saurait plus le contester, que même un étudiant en Lettres peut aujourd’hui entamer beaucoup de recherches à l’aide du monde numérique. Ses résultats seront parfois plus complets et plus rapidement atteints qu’en bibliothèque. Mais le numérique introduit une distance supplémentaire au savoir, car la multitude des réseaux, la richesse des banque de données et le fonctionnement des moteurs de recherche sont moins faciles à comprendre que les fichiers d’une bibliothèque. M. Doueihi se montre convaincu que le cap numérique est déjà largement dépassé : pour lui nous sommes dans ce monde nouveau et un retour en arrière est impossible. Néanmoins, nous ne connaissons pas encore les mythes, les récits, les secrets, les influences et les chances du numérique. M. Doueihi nous ouvre plusieurs voies pour les découvrir et les penser. Même si l’utilisateur peine à penser en termes d’« humanisme numérique » quand l’ordinateur lui refuse ses services, on comprend que M. Doueihi souhaite analyser comment le numérique pourra un jour influencer notre perception du monde. Son livre lui donne raison. Cela ne nous empêchera pas de songer, par exemple, aux études de lettres sans ordinateur, qui nous ont permis autrefois de lire davantage et d’étudier aussi rapidement voire plus vite qu’aujourd’hui. Les fichiers de la bibliothèque nous conduisaient rapidement à l’essentiel. Ce temps est révolu. Et le monde numérique est en train de nous forger d’autres mythes et un autre imaginaire. Dans cinq ans, j’écrirai un nouveau compte-rendu du livre de M.Doueihi.
Heiner Wittmann

Milad Doueihi
Pour un humanisme numérique
Paris:
 Seuil
Seuil, 2011.
180 S.
ISBN 978.2.02.100089.4
Dieses Buch untersucht, die Auswirkungen der Digitaltechnk auf unsere Gesellschaften, unsere Art zu Denken und unsere Werte. Milad Doueihi möchte die Zukunft der digitalen Gesellschaft bewerten. Das wird nicht nur eine Welt der Arbeit sein, sondern auch alle anderen Bereiche des sozialen Lebens betreffen, die davon auf engste Weise abhängig werden. Man wird wohl kaum übertreiben, wenn man davon ausgeht, dass die digitale Umwandlung uns keine Wahl lassen wird. Eigentlich ganz ohne Aufregung, überschreitet Milad Doueihi eine Schwelle und bezieht in seine Überlegungen über die Zukunft unserer Zivilisation Begriffe mit ein, die aus unserer humanistischen Tradition, aus der Dichtung stammen, und sich auf die Freundschaft beziehen.
Auf der ersten Seite seiner Untersuchung steht: „L’humanisme numérique est l’affirmation que la technique actuelle, dans sa dimension globale, est une culture, dans le sens où elle met en place un nouveau contexte, à l’échelle mondiale, et parce que le numérique, malgré une forte composante technique qu’il faut toujours interroger et sans cesse surveiller (car elle est l’agent d’une volonté économique), est devenu une civilisation qui se distingue par la manière dont elle modifie nos regards sur les objets, les relations, les valeurs, et qui se caractérise par les nouvelles perspectives qu’elle introduit dans le champ de l’activité humaine.“ (S. 9 s.) Mit anderen Worten, M. Doueihi ist sich sicher, dass unser Verständnis der digitalen Welt schon längst durch die Digitaltechnik selbst verändert worden ist, wodurch schon bereits ein digitaler Humanismus entstanden ist. Dieser Ausdruck wird den Leser überraschen, denn er bedeutet eine Art Vereinnahmung aller unserer Aktivitäten und meint, wir können uns der Digitaltechnik ncht mehr entziehen. Es ist richtig, die Computer lassen uns keine Wahl mehr. Ein PC-Fehler setzt uns Gefahren aller Art aus, wie auch der Verlust von Daten schon mehr oder weniger schwere Konsequenzen für unsere persönlichen Aktivitäten haben kann.
Auch wenn wir uns über diese Abhängigkeit bewusst sind, könnten man doch zögern, Humanismus und die Digitaltechnik miteinander zu verbinden, denn wie sollte man den Humanismus einer Technik unterordnen oder gar der digitalen Welt erlauben, unseren Humanismus näher zu definieren. – Jedoch „humanisme numérique“ bezieht sich in diesem Buch mehr auf „digital humanities“, einen Ausdruck der wortwörtlich übersetzt wird: er bezeichnet die Verwendung der Digitaltechnik in den Sozial- und Literaturwissenschaften, ohne sich direkt auf die „humanistische“ Auswirkung dieser digitalen Kultur zu beziehen.
Milad Doueihi zeigt sich überzeugt dass „la culture du livre et de l’imprimé“ (S. 10) aufgrund der digitalen Entwicklung in eine Krise geraten ist. Die Besucher der letzten großen Buchmesse in Leipzig scheinen M. Doueihi zu widersprechen, denn trotz der großen Ankündigungen zugunsten der E-Books ist es kaum sichtbar. Und bedenkt man, dass das Internet z. B. Beispiel für einen Studenten, der eine Seminar- oder Abschlussarbeit verfasst, ausser Datenbanken und wichtigen Websites der Bibliotheken nicht viel zu bieten hat, wird man verstehen, dass der Begriff digitaler Humanismus übertrieben sein kann. Sicher, es gibt eine gewissen Einfluss der Digtaltechnik auf unsere Kultur, aber nicht mehr.
Die erste Seite führt schon zu viel Widerspruch. Aber lesen wir mal weiter. Milad Doueihi wird ohne Zweifel Belege für seine These vorlegen. Sein erstes Kapitel enthält weitere Definitionen. Beschleunigung, Schnelligkeit und sofortige Aktionen (S. 11) sind für ihn Zeichen des digitalen Wandels (S. 12), der uns voll erfasst hat. Es gibt kein Zurück mehr. M. Doueihi gebraucht ein Bild: „L’urbanisme virtuel est le site de la culture anthologique naissante, de cette culture à la fois lettrée et populaire, savante et amatrice.“ (S. 17). Man muss dieser Aussage einen gewissen Teil an Wahrheit zugestehen: der Wunsch nach ständiger Mobilität produziert eine „culture mobile“, (p. 18), die durch das Cloud Computing die Fragmenatierung des Wissens, und eine „anthologisation du savoir“ fördert. Mit diesen beiden Begriffen setzt Milad Doueihi seine Analyse fort. Er definiert das, was auf Humanities Computing folgt: “ Digital Humanities est le terme courant qualifiant les efforts multiples et divers de l’adaptation à la culture numérique du monde savant.“ (S. 22)
DIe digitale Technik, so Milad Doueihi, hat uns bereits überholt. Der digitale Wandel ist unsere Wirklichkeit. Jeder Student, ob er nun auch Literatur oder Philosophie studiert, muss sich mit der Computertechnik auskennen, um mit Erfolg und schnell studieren zu können, könnte man daraus ableiten. Aber anstatt die digitale Welt lediglich als eine Fatalität zu akzeptieren, schlägt Milad Doueihi uns vor, selbst zu versuchen, diese Technik zu beherrschen, um sie zu überschreiten, ihr voranzugehen.
EIn Beispiel aus der digitalen Welt: . La „numérisation massive de nos archives“ (p. 26) beschert uns auch neue Probleme. Die Digitalisierung ist nicht unbedingt ein großer Vorteil, denn Forscher interessieren sich auch für den Zustand des Dokuments, so wie ein Archäologe mit dem Fundgut erst dann etwas anfangen kann, wenn er weiß, wie es in situ vorgefunden wurde, ohne dass es durch andere Personen verändert worden ist. Die vermeintlichen Vorteile ders Digitalisierung können nicht immer überzeugen.
Ein digitales Dokument, das weiß auch Milad Doueihi, modifiziert auch die Art und Weise, wie es gelesen wird. Dazu kommt, dass auf diese Weise digitale Texte auf andere Arten verfasst werden. Man nennt das „Demokratisierung“ (Sp. 45). M. Doueihi setzt zu Recht diesen Ausdruck in Anführungszeichen, denn die Demokratie als Herrschaftsform kann nicht mit Aktivitäten einer großen Menge von Personen einfach gleichgesetzt werden.
Das lange Kapitel über die Freundschaft weist auf die Stärke der sozialen Netzwerke hin, deren Austausch zum Zeichen eines neuen „virtuellen Urbanismus“ (S. 73) werde. Die kritische Distanz, die M. Doueihi zu diesen Netzwerken behält, erlaubt ihm die Gefahren und Fallen zu erkennen, denen z. B. > Facebook seine Teilnehmer aussetzt. Der Gemeinschaftsaspekt selbst in einem sozialen Netzwerk funktioniert nur in dem Maße, wie die Teilnehmer selber an die Vorteile glauben, die sie aus diesem Netzwerk ziehen. Keiner bleibt dort lange, ohne nicht einen gewissen mehr oder weniger großen Gegenwert für sein Engagement zu erhalten; die Währung des Webs heißt Aufmerksamkeit. (Sp. 98). Diesen Aspekt scheint aber M. Doueihi zu vernachlässigen, selbst wenn er die „digitale Einsamkeit“ ausführlich analysiert. (S. 85-91)
Das Kapitel über die „culture anthologique“ (S. 105-138) stellt Überlegungen zu den Beziehungen zwischen Lesen und Schreiben vor:> www.storify.com, > www.readsocialapi.com oder die Website > www.qwiki.com sind Angebtote, mit denen Geschichten geschrieben und Gemeinschaftsaspekte integriert werden können. Milad Doueihi untersucht diese Angebote unter dem Aspekt der „prolifération“ und der „segmentation“ (S. 111-118) der Information. Alle drei Angebote gehören zum Mitmach-Netz oder sozialem Netz. Eines ihrer wichtigsten Kennzeichen ist immer die Kombination vierl verschiedener Varianten. Daraus entstehte „une sociabilité numérique“ (Sp. 115, 125) die, so M. Doueihi „…met en place une nouvelle réalité, des conditions de sociabilité qui sont génératrices de nouvelles valeurs.“ (S. 125). Trotzdem darf man anmerken, dass die Bilanz von > www.france-blog.info auf Facebook eher negativ ist. Ohne eine verstärkte Aktivität (zum Nachteil des Blogs) steigt die Anzahl der Freunde des Blogs auf Facebook nur sehr geringfügig. Und wer hat wirklich Lust für Facebook zu arbeiten und seinen Blog zu vernachlässigen? – In diesem Sinne erkennt auch M. Doueihi an, dass sich mit diesen Aktivitäten die Verhältnisse von „le privé et le confidentiel“ verändern.
Websites, die Texte mehr oder weniger automatisch sammeln, versuchen, ihnen eine Art Mehrwert zu vermitteln, in dem sie in einer andern Form dargestellt werden. Ist das ein Spiel? > www.qwiki.com/q/Jean-Paul_Sartre . – Es gibt noch ein anderes Problem. Qwiki erinnert daran, dass jeder Autor oder die „kollektive Intelligenz “ seine Texte und damit die Rechte an ihnen der Allgemeinheit übergibt. Andere dürfen dann Wörter oder Sätze verändern, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt. Das Individuum verschwindet immer mehr, wenn das Kollektiv die Kontrolle über die Texte übernimmt. Kollektive Intelligenz, Auflösung individueller Rechte, da darf man sich die Frage stellen, ob das mit dem digitalen Humanismus zusammenpasst? Sowie ein Artikel in Wikipedia veröffentlicht wird, erscheinen die Korrektoren, Form und Inhalt werden von ihnen untersucht, oft, und man muss zugeben, offenkundige Fehler verschwinden wie von Zauberhand sofort. Aber man braucht nur in den > Archiven der Korrekturen zu blättern, um zu verstehen, dass die Korrektoren trotz ihrer großen Zahl langsam sind und sich ein jeder unter sie mischt.
Auf dem Frankreich-Blog:
 Peut-on encore exister sans Internet? Oder kann man ohne das Internet studieren?
Peut-on encore exister sans Internet? Oder kann man ohne das Internet studieren?
 Ecrivez-vous à la main ou tapez-vous au clavier ?
Ecrivez-vous à la main ou tapez-vous au clavier ?
Die Konstruktion von Sinn, das Schreiben einer Geschichte in der digitalen Welt eröffnet eine neue Epoche: „La production du contenu n’est plus désormais le privilège des humains.“ (S. 145 im Kapitel „Oubli de l’oubli“). Man denkt möglicherweise an die Schwächen der Suchmaschinen, die uns eine Orientierung in der digitalen Welt vorgaukeln und gerne so tun, als ob sie unsere Vorlieben erraten könnten. Die Versuchung, uns viel Werbung zu präsentieren ist immer der Absicht, uns gute Suchresultate zu präsentieren voraus. M. Doueihi weiß, dass die digitale Welt unsere Beziehungen zum Gedächtnis modifiziert und uns auch den Schein vermittelt, alles sei erreichbar. (cf. S. 152). Und das was man vergisst? Weiter oben hat M. Doueihi schon darauf hingewiesen, dass Facebook das definitive Löschen eines Profils erschwert und alle nur denkbaren Mittel einsetzt, um eine Person als Teilnehmer in Facebook zu halten.
Archive im Internet speichern, ohne die Rechjteinhaber zu fragen, die verschiedenen Versionen einer Website. Facebook hat das Ansinnen, auf Fotos, die Gesichter meiner Freunde kennzeichnen zu wollen. Und HGoogel nimmt sich das Recht heraus, Bilder und Grafiken ohne Erlaubnis einfach zu sammeln und anzuzeigen. Ein Foto, das man auf einer Website zeigt, ist künftig kaum noch löschbar: „…effacer doit être un droit,“ (S. 154) fordert M. Doueihi zu Recht.
M. Doueihi will nicht, (cf. S. 163) von einem „technologischen Schrecken“ sprechen, er zieht es eine „Vorstellung der digitalen Welt“ zu beschreiben und sich zu fragen, ob sie „eine neue Teilung zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt bedeutet“ (S. 166) Es stimmt, man wird es heute nicht bestreiten, dass ein Student der Literaturwissenschaft mit Hilfe der digitalen Welt forschen und lernen kann. Manchmal werden seine Ergebnisse sogar besser sein, als wenn er in die Bibliothek gehen würde. Dennoch: die digitale Welt schafft eine zusätzliche Distanz zum Wissen, denn die Vielfalt der Netz, der Reichtum der Datenbanken und die Funktionsweise der Suchmaschinen sind viel schwerer zu verstehen als die Nutzung einer Bibliothek
Auf dem Frankreich-Blog:
 170 Artikel zum Web 2.0
170 Artikel zum Web 2.0
M. Doueihi ist überzeugt, dass das digitale Kap bereits umrundet ist. für ihn sind wir in der Neuen digitalen Welt längst angekommen. Wir kennen aber ihre Mythen, ihre Geheimnisse wie auch ihre Chancen noch nicht. Selbst wenn ein Internet-Anwender Schwierigktien hat, die Neue Welt als einen „digitalen Humanismus“ zu begreifen, wenn der PC ihm seien Dienste verweigert, dann versteht, wieso und warum M. Doueihi den Einfluss der digitalen Welt auf unser Verhalten analysieren möchte. Sein Buch gibt ihm Recht. Das hindert uns aber nicht daran, von einem Literaturstudium ohne PC zu träumen, was uns früher erlaubt hat, viel mehr Bücher zu lesen und schneller zu studieren. Die Karteikästen der Bibliotheken führen uns schnell zum Wesentlichen. Soll diese Zeit wirklich vorbei sein? Die digitale Welt wird uns erst noch ihre Mythen zeigen und erklären müssen. In fünf Jahren verfasse ich eine neue Rezension des Buches von M. Doueihi.
Heiner Wittmann
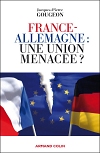
![]() Armand Colin 2012. 216 p.,
Armand Colin 2012. 216 p.,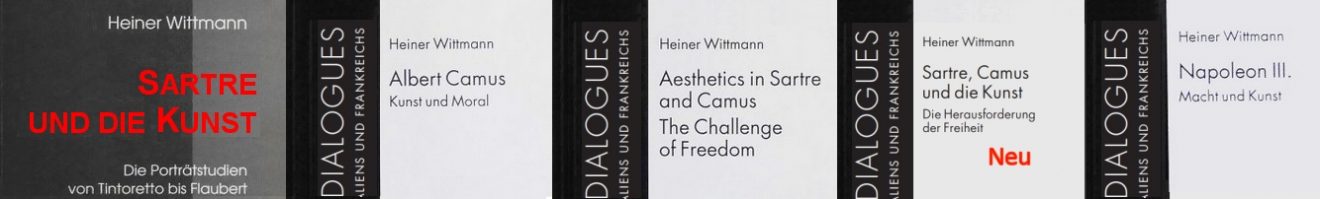



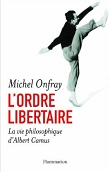


 Milad Doueihi
Milad Doueihi
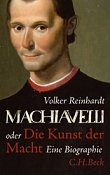

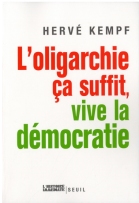
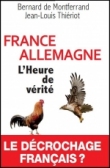 Bernard de Monferrand, Jean-Louis Thiérot,
Bernard de Monferrand, Jean-Louis Thiérot,