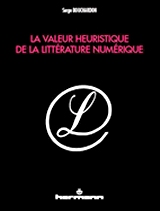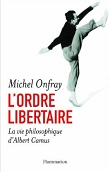Napoleon III. Macht und Kunst, Reihe Dialoghi/dialogues. Literatur und Kultur Italiens und Frankreichs, Hrsg. v.
Napoleon III. Macht und Kunst, Reihe Dialoghi/dialogues. Literatur und Kultur Italiens und Frankreichs, Hrsg. v.  Dirk Hoeges, Band 17,
Dirk Hoeges, Band 17,
 Verlag Peter Lang, Frankfurt, Berlin, Bern u.a., 2013.
Verlag Peter Lang, Frankfurt, Berlin, Bern u.a., 2013.
Hardcover. ISBN 978-3-631-64209-2
 Online bestellen
Online bestellen  Rezensionsexemplare
Rezensionsexemplare
 Lizenz kaufen, Übersetzungsrechte
Lizenz kaufen, Übersetzungsrechte
Bibliographie:  Über Napoléon III
Über Napoléon III  Sekundärliteratur
Sekundärliteratur  Websites
Websites
Die folgende Bibliographie enthält nur eine kleine Auswahl aus der Gesamtbibliographie, die seit 1988 zu diesem Thema gesammelt und ausgewertet wurde:
Bibliographie:
Louis-Napoléon, Werke
Œuvres de Louis-Napoléon Bonaparte, Temblaire, Ch. E. (Hrsg.), 3 Bde., Paris 1848.
Napoléon III, La politique impériale exposée par les discours et proclamations de l’Empereur Napoléon III depuis le 10 décembre 1848 jusqu’en février 1868, Paris 1868.
Napoléon III, Histoire de Jules César, Bd. I., Paris 1865, S. I-VII.
Napoléon III: Discours prononcé par l’Empereur à la séance d’inauguration de l’Exposition universelle (15 mai 1855, in: Prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte, Rapport sur l’exposition universelle de 1855 présenté à l’Empereur par S.A.I. le Prince Napoléon, président de la commission, Paris 1856.
Napoléon III: Discours prononcé par l’Empereur à la séance d’inauguration de l’Exposition universelle (15 mai 1855, in: Prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte, Rapport sur l’exposition universelle de 1855 présenté à l’Empereur par S.A.I. le Prince Napoléon, président de la commission, Paris 1856.
Louis-Napoleon, L’extinction du Paupérisme und Le canal de Nicaragua un projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique au moyen d’un canal im Anhang seiner Studie, in: J. Sagnes, Les racines du socialisme de Louis-Napoléon Bonaparte. Le paupérisme des années 1840, Toulouse 2006,
Louis-Napoléon, Manifeste du Prince Louis-Napoléon, Paris 27 novembre 1848. Paris 1848
Briefe
Kühn, J., Napoleon III. Ein Selbstbildnis in ungedruckten und zerstreuten Briefen und Aufzeichnungen, Arenenberg 1993.
Le secret du Coup d’état. Correspondance inédite du Prince-Louis Napoléon, de MM. de Morny, de Falhault et autres (1848-1852) . Publié avec une étude de P. Guedalla. Übers. v. Baron J. de Maricourt, Paris 1928.

Über Napoleon III  Websites
Websites
Anceau, E., La France de 1848 à 1870. Entre ordre et mouvement, Paris 2002.
— Napoléon III, Paris 2008.
Anon., Procès de Napoléon-Louis Bonaparte et de ses coaccusés devant la cour des pairs, contenant les faits préliminaires, les documents officiels, les relations particulières, la biographie des principaux accusés, les interrogatoires, débats, réquisitoires, arrêts, etc., Paris 1840.
Aprile, S., La IIe République et le Second Empire 1848-1870 du Prince Président À Napoléon III, Paris 2000.
— L’espion, frère du proscrit. Regards croisés sur la surveillance politique des exilés sous le second Empire, in: Cultures & Conflits, 53, printemps 2004, online seit 4.10.2004. URL: www.conflits.org/index989.html. Aufgerufen am 2. Januar 2010.
Aubry, O., Le Second Empire (1938). Paris 1941.
—, Napoleon III, conspirateur et empereur, Paris 1958.
Bac, Ferdinand, Intimités du Second Empire, 3. vol., Paris 1931.
—, La Cour des Tuileries sous le Second Empire, Paris 1930.
—, Napoléon III inconnu, Paris 1932.
Bloch, J.-J., Delort, M., Quand Paris allait „à l’expo“, Paris 1980.
Baguley, D. (Hrsg.), Art and Literature of the Second Empire. Les arts et la littérature sous le Second Empire, Durham 2003. — Napoléon III and his Regime. An Extravaganza, Baton Rouge, Louisiana 2000.
Barins, Histoire populaire de Napoléon III suivie d’une notice historique sur l’impératrice Eugénie, Paris 1853.
Bluche, F., Le bonapartisme, Aux origines des la droite autoritaire (1800-1850), Paris 1980.
—Le despotisme éclairé, Paris 1980.
Bornecque-Winandy, E., Napoléon III, empereur social, Paris 1980.
Bruyère-Ostells, W., Napoleón III et le second Empire, Paris 2004.
Castelot, A., Napoleon III et le Second Empire, t. 1-5, Paris.
—, Napoleón Trois, t. 1er, Des prisons au pouvoir, Paris 1973.
— Napoléon III, 4 vol., Paris 1975-1976.
—, Romans vrais de l’histoire, Paris 1973.
Castelot, A., Napoléon Trois, Bd. I, Des prisons au pouvoir, Paris 1973.
Dansette, A., Du 2 décembre au 4 septembre. Le Second Empire, Hachette, Paris 1972.
— Naissance de la France moderne. Le Second Empire, Hachette, Paris 1976.
— Histoire des Présidents de la République. de Louis-Napoléon à Vincent Auriol, Paris 1953.
— Napoléon à la conquête du pouvoir, Paris 1961.
Dion-Tenenbaum, A., Les appartements Napoléon III du musée du Louvre, Paris 1993.
Dumas, A., Napoléon, Paris 1840.
Dunoyer, Ch., Le Seconde Empire et une nouvelle Restauration, London 1864
Duprat, P., Les tables de proscription de Louis-Bonaparte et de ses complices, 2 Bde., Liège 1852.
Durrieu, X., Le coup d’Etat de Louis Bonaparte, Brüssel 1852.
Engelhard, M., L’Empire démasqué, Brüssel 1867.
Engelsing, Tobias, Napoleon der Letzte, in: DIE ZEIT, 3.4.2008.
Gallix u. Guy, Histoire complète et authentique de Louis-Napoléon Bonaparte depuis sa naissance jusqu’à ce jour; précédée d’un avant-propos intitulé Le 2 décembre devant l’histoire, Paris 1852.
Girard, L., La Cour de Napoléon III, in: K.F. Werner, Hof, Kultur und Politik im 19. Jahrhundert, Pariser Historische Studien, Bd. 21, Bonn 1985, S. 155-167,
—, La IIe Republique, Paris 1968.
—, La Politique des travaux publics du second Empire, 2 vol., Paris 1964/65.
—, Questions politiques et constitutionnelles du second Empire, Paris 1972.
— u.a., Les Elections de 1869, Paris 1960.
—, Napoléon III, Paris 1986.
Gollwitzer, H., Der Cäsarismus Napoleons III im Widerhall der öffentlichen Meinung Deutschlands, in: ders. Weltpolitik und deutsche Geschichte: gesammelte Studien, hg. v H.-Ch. Kraus, Göttingen 2008, S. 239-286, zuerst erschienen in: Historische Zeitschrift 173 (1952), S: 23-75.
Granger, C., La liste civile de Napoléon III: le pouvoir impérial et les arts, Paris 2005.
Groh, D., Cäsarismus, Napoleonismus, Führer, Chef, Imperialismus, in: O. Brunner, W. Conze, R. Konsellek, Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politischen sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1972, S. 726-771.
Grün, K. Th. F., Louis Napoleon Bonaparte, die Sphinx auf dem französischen Kaiserthron, Hamburg 1859.
Hanna, K. A., Napoleon III and Mexiko. American Triumph over Monarchy, Chapel Hill, N.C. 1972.
Hauterive, E. d‘, Napoléon III et le Prince Napoléon. Correspondance inédite (1925).
Hazareesingh, S., Bonapartism as the Progenitor of Democracy. The Paradoxical Case of the French Second Empire, in: P. Baehr, M. Richter, Dictatorship in History and Theory. Bonapartism, Caesarism, and Totalitarianism, Cambridge 2004, S. 129-152. — The Legend of Napoleon, London 2004.
Hanna, K. A., Napoleon III and Mexiko. American Triumph over Monarchy, Chapel Hill, N.C. 1972.
Hauterive, E. d‘, Napoléon III et le Prince Napoléon. Correspondance inédite (1925).
Hazareesingh, S., Bonapartism as the Progenitor of Democracy. The Paradoxical Case of the French Second Empire, in: P. Baehr, M. Richter, Dictatorship in History and Theory. Bonapartism, Caesarism, and Totalitarianism, Cambridge 2004, S. 129-152. — The Legend of Napoleon, London 2004.
Herre, F., Napoléon III. Glanz und Elend des Zweiten Kaiserreichs, München 1990.
Hugo, V. Napoléon-le-Petit, London, Brüssel 1852.
Leduc, Edouard, Louis-Napoléon Bonaparte, le dernier empereur, Paris 2010.
Leguèbe, Eric, Napoleon III le grand, Paris 1978.
Malardier, Pierre, Napoléon III et le coup d’Etat européen, London 1861.
— Un César déclassé à la recherche d’un empire, London 1861.
— Ni Pape ni empereur, London 1861.
Marx, K., Der achtzehnte Brumaire des Louis-Napoleon, in: K. Marx, F. Engels, Werke, hg. v. Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Band 8, Berlin 1973.
Milza, P., Napoléon III, Paris 2004.
— Milza, P. (Hg.), Napoléon III, L’homme, le politique. Actes du colloque organisé par la Fondation Napoléon. Collège de France, amphithéâtre Marguerite de Navarre, 19-20 mai 2008, Paris 2008.
Minc, A., Louis Napoleón revisité, Paris 1997.
Miquel, P., Le Second Empire, Paris 1992.
Sagnes, J. Les racines du socialisme de Louis-Napoleón Bonaparte, Toulouse 2006.
— Napoléon III. Le parcours d’un saint-simonien, Sète 2008.
Séguin, P., Louis Napléon le Grand, Paris 1990.
Sencourt, Robert, Napoleon III. The Modern Emperor (Repr. of 1933) .
Sérieyx, W., L’appel au sauveur… L’ascension de Louis Bonaparte. 1832-1848, Paris 1935, 1955.
Smith, W. H. C., Napoléon III (engl. Napoléon III, London 1972), Paris 1982. —, Eugénie. Impératrice et femme, 1826-1920, Paris 1989. LB
Spillmann, Gén. Georges, Napoléon III. Prophète méconnu, Paris 1972. [8°Lb56.3717
Temblaire, Ch. – E., Évasion du prince Napoléon-Louis. Procès du docteur Conneau, prévenu d’avoir procuré et favorisé l’évasion du prince, Paris 1846.
Willms, J., Napoleon III. Frankreichs letzter Kaiser, München 2008.
Winandy, Philippe de, Le Secret de Napoleon III ou la Machine de la fraternité. Napoléon et les frères Péreire, Neuilly 1983.
 Sekundärliteratur
Sekundärliteratur  Über Napoléon III
Über Napoléon III  Websites
Websites
Adoumié, V., Histoire de la France: De la monarchie à la république 1815-1879, Paris 2004.
Alain, R., L’hypothèse « bonapartiste » et l’émergence des systèmes politiques semi-compétitifs, in: Revue française de science politique, Nr. 6, 1975, S. 1077-1111.
Alexander, R. S., ‘The Hero as Houdini: Napoleon and 19th-century Bonapartism’, in: Modern & Contemporary France, Volume 8, Number 4, 1 November 2000, pp. 457-467.
Ameil, G., Nathan, I., Soutou, G.-H. (Hrsg.), Le Congrès de Paris (1856). Un événement fondateur, Bruxelles/Bern/Berlin 2009.
Anceau, E., La France de 1848 à 1870. Entre ordre et mouvement, Paris 2002.
Anon., La Censure sous Napoléon III, Rapports inédits et in extenso (1852-1866), Préface de *** et interview de E. de Goncourt, Paris 1892.
Anon., Le Brigand corse ou Crimes, forfaits, attentats et péchés de Nicolas Bonaparte, depuis l’âge de treize ans jusqu’à son exil de l’île de Sainte-Hélène, Paris, o.J.
Badea-Päun, G., Le style Second Empire. Architecture, décors et art de vivre, Paris 2009.
Benoît, J., Delannoy, A., Pougetoux, A., Le retour des cendres (1840-1990), Mort et résurrection, Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préai , 30 mai – 1er octobre 1990. La ferveur populaire. Musée Poybet-Fould, 10 octobre – 16 décembre 1990, Paris 1990.
Beßlich, B., Der deutsche Napoleon-Mythos. Literatur und Erinnerung. 1800–1945, Darmstadt 2007.
Bouillon, J.-P. (Hg.), La critique d’art en France. 1850-1900. Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 25, 26, 27 mai 1987, Sainte-Etienne 1989.
Burke, P., Was ist Kulturgeschichte?, übers. v. M. Bischoff, Frankfurt, 2005.
Capefigue, J.-B.-H.-R., L’Europe pendant le consulat et l’empire de Napoléon, Bd. 7, Brüssel 1840
Chasles, Emile, Histoire de France abrégée contenant l’histoire du travail et celle du progrès agricole, commercial, industriel et maritime, Paris 1869.
Chassé, Charles, Napoléon par les écrivains, Paris 1921.
Choisel, F., Bonapartisme et gaullisme, Paris 1987.
Descotes, M., La légende de Napoléon et les écrivains du XIXe siècle, Paris 1967.
Farat, H., Persigny. Un ministre de Napoléon III. 1808-1872, Paris 1957.
Ganzin, M., (Hg.), Du Césarisme au Césarisme moderne. IIème Table ronde. Lyon, 11 et 12 décembre 1998. Faculté de Droit Jean Moulin Lyon III, Aix-en-Provence 1999.
Garnier-Pagès, L.-A. M., Un episode de la revolution de 1848: l’impôt des 45 centimes, 2è édition, Paris 1850.
Garrigues, J., La France de 1848 à 1870, Paris 1995.
Gautier, T., Critique d’art. Extraits des Salons (1833-1872), hg. v. M.-H. Girard, Paris 1994.
— Exposition du Louvre. 3e article, Eugène Delacroix, in: La Presse, 22 mars 1838, wiederabgedruckt in: Gautier, Journaliste. Articles et chroniques, hg. v. P. Berthier, Paris 2011, S 68-75.
— L’art en 1848, in: L’Artiste. Revue de Paris, V. série, Bd. I, Paris 1848, S. 113-115.
— Gautier, Journaliste. Articles et chroniques, hrsg. v. P. Berthier, Paris 2011,
Gay, P., Die Moderne. Eine Geschichte des Aufbruchs, übers. V. M. Bischoff, Frankfurt/M., 2008.
Gayot, A., Guizot et Madame Laure de Gasparin, Documents inédits (1830-1864), Paris 1934.
Godechot, J. (Hg.), Les constitutions de France depuis 1789, Paris 1970.
Guizot, F., Lettres à sa famille et à ses amis receuillies par Mme Witt née Guizot, Paris 1884. — Correspondance avec Léonce de Lavergne, hrs. v. E. Cartier, Paris 1910. — De la démocratie en France, Paris 1849. — Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Bd. II, IV, VI, Paris, Leipzig 1859-1861. — Monk. Chute de la République et rétablissement de la monarchie en Angleterre, en 1660, Paris 1851.
Heine, Heinrich, Lutetia, in: Heine, Sämtliche Schriften 1831-1855, hrsg. Karl Heinz Stahl, [Sämtliche Schriften, hrsg. Klaus Brieglieb], Band 9, Frankfurt/M 1981, S. 217-495. Französische Zustände, in: Heine, Sämtliche Schriften 1831-1837, hrsg. Karl Pörnbacher, [Sämtliche Schriften, hrsg. Klaus Brieglieb], Band 5, Frankfurt/M 1981, S. 89-279.
Herbet, R. L., Impressionismus. Paris – Gesellschaft und Kunst, übers. v. H. Betz, Stuttgart, Zürich 1989.
Hoeges, D., Alexis de Tocqueville – Literatur im Zeitalter der Gleichheit, in: Siegener Hochschulblätter 1982, S. 44-55.
— Der vergessene Rest. Tocqueville, Chateaubriand und der Subjektwechsel in der französischen Geschichtsschreibung, in: Historische Zeitschrift Bd. 238, 1984, S. 287-310.
— François Guizot und die Französische Revolution, Frankurt/M., Bern, ²1981.
— Guizot und Tocqueville, in: Historische Zeitschrift, Bd. 218/2, München 1974, S 338-353.
— François Guizot (1787-1874), in: H. Duchhardt, M. Morawiec, W. Schmale. W. Schulze (Hg.), Europa-Historiker, Band 3. Ein biographisches Handbuch, Göttingen 2007, S. 89-111.
Hugo, Victor, Choses vues. Journal de ce que j’apprends chaque jour. Faits contemporains. Le temps présent, hrsg. Jean-Claude Nabet, Caroline Raineri, Guy Rosa, Carine Trévisan, Paris 1987, S. 591-1137.
Jenny, Adrian Jean-Baptiste, Adolphe Charras und die politische Emigration nach dem Staatsstreich Louis-Napoléon Bonapartes. Gestalten und Wirkungen der französischen Flüchtlinge, Basel, Stuttgart 1969.
Joly, M., Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, Paris 1992.
Jordan, D., Die Neuerschaffung von Paris. Baron Haussmann und seine Stadt, übers: v. H. G. Holl, Frankfurt/M. 1996.
Lamartine, A. de, Correspondance, V. de Lamartine (Hg.), 6 vol., 1873-1875.
— Correspondance Générale de 1830 à 1848, hg. M. Levaillant, t. I. Droz, 1943, t. II, Lille, Giard, Genf, Droz 1948.
— Discours sur la subvention des théâtres nationaux, 16.4.1850.
— La Politique et l’histoire, Coll. Acteurs de l’histoire, Paris 2000.
— Sur la politique rationnelle, Genève/Paris 1977.
— Correspondance Générale de 1830 à 1848, hg. M. Levaillant, t. I. Droz, 1943, t. II, Lille, Giard, Genf, Droz 1948.
— Histoire de la Révolution de 1848, 2 Bde, Paris 1849.
— Le conseiller du Peuple. Journal, 2 vol., Bruxelles 1849/1850.
Lamennais, H. F. R. de, Projet de constitution de la République française, Paris 1848.
Larousse, Larousse, Pierre, Début du Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle (1864-1876)
Las Cases, Comte de, Mémorial de Sainte-Hélène, éd. J. Prévost, 2 t., Paris 1935. — Mémorial de Sainte-Hélène, éd. Jean Prévost, 2 t., Paris 1956. — Mémorial de Sainte-Hélène, éd. J. Marcel Dunan, 2 t., Paris 1983.
Lepenies, W., Sainte-Beuve. Auf der Schwelle zur Moderne, München, Wien 1997.
Lucas-Dubreton, J., Le culte de Napoléon, 1815-1848, Paris 1960.
Luchaire, F., Naissance d’une constitution: 1848, Paris 1998.
Mainardi, Patricia, Art and Politics of the Second Empire: The Universal Expositions of 1855 and 1867, London 1867, New Haven, Conn. 1987. – The Political Origins of Modernism, in: art Journal, 1/1985 (11-17).
Marion, J., Palvadeau, Ch., L’insurrection de Linards. St-Paul, St. Bonnet, Chateauneuf. 6 Décembre 1851, Société historique du Canton du Chateauneuf-La-Forêt, o. O. 1998.
Marx, K., Engels, F., Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850. I. Die Juniniederlage 1848, in: K. Marx, F. Engels, Werke, hg. v. Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Band 10, Berlin 1977, S. 119-196.
Ménager, B., Les Napoléon du peuple, Paris, 1988.
– — Force et limites du bonapartisme populaire en milieu ouvrier, in: Revue historique, 265 (1981), S. 371–388
Norvins, J. Marquet de Montbreton, bon de, Histoire de Napoléon Paris 111839. Ier, 4 vol., 1827-1828
Ollivier, Emile, L’Empire libéral, 1895-1918, hg. Théodore Zeldin, Anne Troisier de Diaz, Paris 1916
Picon, G., 1863. Naissance de la peinture moderne, Paris (1974) 1988.
Pimienta, R., La propagande bonapartiste en 1848, Paris 1911.
Pyta, W., (Hg.) Das europäische Mächtekonzert. Friedens- und Sicherheitspolitik vom Wiener Kongress 1815 bis zum Krimkrieg 1853, (Stuttgarter Historische Forschungen, Bd. 9), Köln, Weimar, Berlin 2009. — Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler, Berlin 3/2007.
Quérard, J. M., Les Bonaparte et leurs œuvres littéraires: Essai historique et bibliographique contenant la généalogie de la famille Bonaparte et des recherches sur les sources de l’histoire de Napoléon, Paris 1845.
Rémond, René, La vie politique en France, 2 t. 1848-1879, Paris 1969.
Renan, E., La poésie de l’exposition, in: Les Débats, 1855. L’Avenir de la science, Paris (1848) 1890. Histoire générale et système comparé des Langues sémitiques, 1855. Questions contemporaines, Paris 1868. L’avenir de la science, 1848, publ. 1890.
Riemenschneider, R., Dezentralisation und Regionalismus in Frankreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Politische Bewegungen gegen den Verwaltungszentralismus im Umkreis der Februarrevolution und napoleonischer Restauration 1851, (Pariser historische Studien, Band 22), Bonn 1985.
Rogeard, A., Pauvre France! Bruxelles 1865, Les propos de Labiénus et à propos Labiénus, London 1865, Le Deux-Décembre et la Morale, Brüssel 1866.
Schoelcher, V., Histoire des crimes du Deux-Décembre, 2 Bde., Brüssel, 1852. Le gouvernement du Deux-Décembre, Brüssel 1853. Histoire de la terreur bonapartiste, Brüssel 1852.
Second Empire: Annales du Sénat et du Corps législatif, 1861-1870 [4° Le80.8 Procès verbaux des séances, [8° Le80.2 (1852-1865 [4° Le80.2 mêmes dates: annexes Compte rendu analytiques des séances [8° Le80.3 (1852-1865) [4° Le80.3 (1866-1870) Sénat.. Procès… [9° Le80.1 (1852-70) [4° Le80.6 (1861-1865
Stierle, K., Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewusstsein der Stadt, München, Wien 1993.
Straub, E., Wagner und Verdi. Zwei Europäer im 19. Jahrhundert, Stuttgart 2012.
Taÿ, H., Le régime présidentiel et la France. Etude d’histoire des idées juridiques et politiques, Paris 1967.
Tocqueville, A. de, 1805-1859, Oeuvres complètes, t. XVI, Mélanges, éd. F. – Souvenirs [ersch. 1893], in: Oeuvres complètes, t. XII, Paris 1964. L’ancien régime et la révolution, Paris 1856
Tousez, A., La vie de Napoléon racontée dans une fête de village. Représente pour la première fois sur le théâtre du Palais Royal. 9.11.1834, Paris 1834, in: Le Magasin théâtral. Choix des pièces nouvelles jouées sur tous les théâtres de Paris. 1re année, Paris, Bruxelles 1834.
Tudesq, A.J., L’élection présidentielle de Louis Napoléon Bonaparte, 10 décembre 1848, Paris 1965. La légende napoléonienne en France de 1848, in: Revue historique 1957, Juillet-septembre, S. 64-85. Les Grands Notables en France, 1840-1849, (2 vol.), Paris 1964.
Tulard, Jean, Nouvelle bibliographie critique des Mémoires sur l’époque napoléonienne écrits ou traduits en français, Droz, Genf 1991.
—, Dictionnaire du Second Empire, Paris 1995.
Werner, K.F. (Hrsg.), Der Bonapartismus, München 1977.
Winock, M., Les voix de la liberté. Les écrivains engagés au XIXe siècle, Paris 2001.
Wouters, F., Les Bonapartes depuis 1815 jusqu’à ce jour, Brüssel 1847.
Yon, J.-C., Le Second Empire. Politique, société, culture, Paris 2004
 Über Napoléon III
Über Napoléon III  Sekundärliteratur
Sekundärliteratur  Websites
Websites
 Professor Dr. Dirk Hoeges ist am 30. Januar 2020 in Köln verstorben.
Professor Dr. Dirk Hoeges ist am 30. Januar 2020 in Köln verstorben.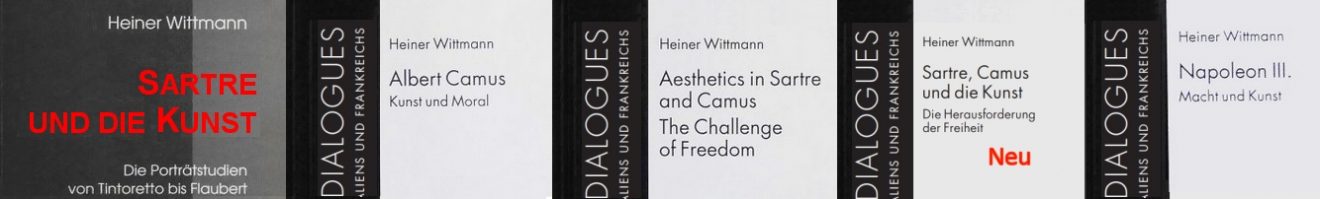
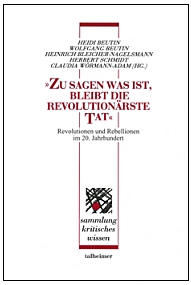
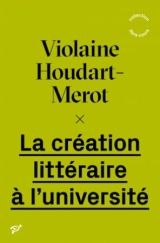 Kann man das Schreiben von literarischen Texten lehren und lernen? In ihrem jüngst erschienenen Band
Kann man das Schreiben von literarischen Texten lehren und lernen? In ihrem jüngst erschienenen Band 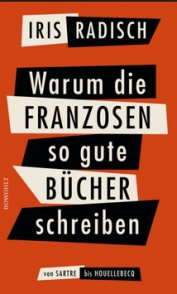 Im Untertitel steht „Von Sartre bis Houellebecq“, beide Autoren werden auf der letzten Seite nochmal genannt. Ob Houellebecq das Erbe von Sartre antritt, mag dahingestellt sein. So bleibt es erst mal dabei, dass dieses Buch mit Sartre beginnt und chronologisch mit Houellebecq endet.
Im Untertitel steht „Von Sartre bis Houellebecq“, beide Autoren werden auf der letzten Seite nochmal genannt. Ob Houellebecq das Erbe von Sartre antritt, mag dahingestellt sein. So bleibt es erst mal dabei, dass dieses Buch mit Sartre beginnt und chronologisch mit Houellebecq endet.