Die digitale Welt – Gibt es bald keine Bücher mehr?

François Bon
après le livre
Paris: ![]() Seuil, 2011.
Seuil, 2011.
275 S.
ISBN 978.2.02.105534.4
Ein spannendes Buch. François Bon beschreibt den Übergang zum digitalen Buch oder Informationsträger. Man kann sich seiner Passion kaum entziehen. Sein letzte Satz „Nous sommes déjà après le livre,“ duldet keinen Widerspruch, nachdem er im vorhergehenden Paragraphen erklärt hat, dass es wichtig sei, zu verstehen, dass der Beginn dieser Entwicklung, die noch im Anfangsstadium steckt genauso irreversibel und total wie ähnliche Entwicklung durch alle früheren Veränderungen des Schreibens und aller Formen des Lesens eingeleitet worden seien. (vgl. S. 270) Und auf der vorhergenenden Seite stellt Bon fest: „Nous venons d’être projetés dans un monde mouvant. Il s’ouvre tout juste.“ Er ist seiner Zeit wirklich voraus. Wenn Studenten heute ihre Seminararbeiten oder ihre Abschlussarbeiten ohen ein Buch schreiben könnten, müsste man Bons apodiktischen Behauptungen noch mehr oder überhaupt Glauben schenken. Solange aber das Internet z.B. bei literaturwissenschaftlichen Arbeiten überhaupt nicht hilft, sondern allenfalls die Ergänzung eine Bibliographie beschleunigt, ohne trotz der Vielfalt im Netz wirklich zu ihrer Vollständigkeit beitragen zu können, möchte man Bons Begeisterung noch nicht so recht teilen.
Lässt man sich aber auf Bons Argumente ein, ergibt sich ein anderes interessantes Bild, und es loht sich, seine Anmerkungen genauer zu lesen. Um es gleich zu sagen, die etwa 40 Abschnitte seines Buches sind möglicherwiese als kürzere oder längere Blogbeiträge entstanden. Ein Buch mit einer traditionellen Kapiteleinteilung könnnte sein Anliegen noch mehr verdeutlichen. So geht sein so interessanter literatur- und Buch – oder editionshistorische Ansatz zwischen einer gewissen Unordung zwar nicht verloren, aber er wird leider etwas unscharf.
Die Veränderung, die wir erleben, ist für ihn unwiderruflich und hat längst begonnen. Es geht um das Schreiben: „Accorder son traitement de texte,“ rät er seinem Leser und gibt zu erkennen, wie jeder Schreibprozess mit all seinen Erscheinungsformen und Formatierungen das Lesen beeinflusst. Lesen und das Schreiben gehört zu seinen Themen. Sein Anfang ist geschickt gewählt. Folglich ist auch das Lesen am Bildschirm etwas anderes als das Lesen einer Buchseite. Und er weiß auch, dass eine Liseuse auch mit einem dicken Buch ausgerüstet keinen dicken Buchrücken hat. Und das stört uns. (S. 25) Selbst das digitale Buch ist für Bon nur ein Übergang. IPad und PC, das Schreiben ändert sich, aber er bleibt dabei: „le corps écrit.“
Und dann erwähnt er die Menge der Websites, die Domainenamen, die er mehr oder weniger besitzt, und was er in den letzten 15 Jahren dort erlebt hat. Die Vielfalt erklärt er mit den Fleurs du Mal, dem Gedichtband Baudelaires, von dessen Editionen er eine ganze Bibliothek besitzt: Für Bon war das immer nur ein Buch. Nebenbei berichtet Bon über seine Erfahrungen im Web. „Nouvel axiome Web:“ Je mehr Türen (Links) sich nach außen öffnen, um so häufiger kommen die Besucher wieder. Und er lässt erkennen, dass man das Internet nur verstehen kann, wenn man am besten alles ausprobiert. Kaum ein Produkt ist in technischer Hinsicht so sophistiqué wie das moderne Buch. Vergleicht man damit das eigene Schreiben und das interne Chaos auf der häuslichen Festplatte, kann man gar nicht glauben, dass Bon, glaubt, wir hätten das Buch bald überwunden.
Bons literaturgeschichtlicher Exkurs z. B. über Balzacs Editionsarbeit ziegt, dass es schon zu Zeiten des Autors der Comédie humaine tiefgreifende Veränderungen des Schreibprozesses und folglich auch der Vermarktung von Literatur gegeben hat. Und mit seiner Druckerei ist > Balzac gescheitert, aber mit seiner Vermarktung in Richtung von Abonnements war er wegweisend. (S. 119). Bon weiß, dass die Lektürgewohnheiten das Schrieben beeinflussen und sich besonders zugunsten der kurzen Form auswirken. (Das sieht man an seinem Inhaltsverzeichnis.).
Zugegeben, auch bei langen Zeitungsaufsätzen, teilen wir uns mit einem Blick den Lesestoff ein. (S. 132) Heute: „La lecture aujourd’hui pass par un cadre et non plus un volume,“ (S. 146) schreibt Bon und meint damit alle Anfeindungen, die die Lektüre am Bildschirm stören. Au revoir, la concentration. Kann da noch der kleine Rahmen der persönlichen Bibliothek reichen, wenn der weltweite Internet-Rahmen so groß ist? Und wer kann sich dem meschlichen Abenteuer Wikipedia noch entziehen? (S. 147) – Nun, die schiere Masse ist eine Perspektive aber noch keine Lösung für literaturwissenschaftliche Hausarbeiten. Was für Bon folgt, ist eine andere Art des Denkens, eine andere Art des Gehens. Immerhin. Er empfiehlt, die eigenen Gewohnheiten zu überprüfen und auf die Konzentration zu achten. Wie viel unnütze Zeit vertut ein Student beim Surfen in der Hoffnung, etwas für seine Seminararbeit zu finden. Bons Erklärungen, wie in der Entwicklung zum Buch die Seite entstand, wie der Titel, die Kapiteleinteilung und schließlich der Begriff des Autors im XVII. Jh. entstand (S. 183), sind richtig spannend und lehrreich. Mit Rabelais kennt sich Bon so gut aus! Das verführt zum Lesen von Rabelais. Eine andere Kapiteleinteilung hätte der Lektor Bon doch empfehlen müssen! Bei der Daumenprobe in der Buchhandlung verrät das Inhaltsverzeichnis eher wenig über den „Plan“ seines Buches. Und dann gibt es all diejenigen, die beim Thema Web immer sagen: „Dazu habe ich keine Zeit,“ – „mettre les mains dans le cambouis pour se faire un site,“ antwortet Bon ihnen und erklärt ihnen was das Teilen im Netz bedeutet. Bons Abneigung gegen das Telefonieren ist seine persönliche Marrotte. Soit. – „… le Web est notre livre – une construction,“ (S. 201) das wäre ein Leben im Web, in der Hoffnung, dort das ganze soziale Leben wiederzufinden. Man kann da ganz schöne alleine sein, wenn nicht das macht, was die anderen auch alle machen. Manche gehen in die Bibliothek um dort zu lesen, zu arbeiten, orditer. Mit dem PC ist man immer weniger allein, meint Bon und vergleicht das PC-und Internetarbeiten mit dem Leben in einer Stadt. Bibliotheken sind nicht her nur Orte, wo Inhalte gehütet werden, sondern sie sind zu Orten geworden, wo diese Inhalte intelligent verteilt werden. Das ist ein interessanter Gedanke, den man weiterverfolgen sollte. Wie gestaltet sich das Verhältnis von Bibliothek und Internet? Eine Wechselwirkung?
> Vergrößert sich dafür in der Bibliothek die Distanz zu den Büchern?
Den Tontafeln und das Lesetablett ist ein langes Kapitel gewidmet. Und ein letztes Kapitel gilt den Spuren, die der Autor bei der Erarbeitung seines Textes hinterlässt. Gibt es noch Brouillons? Oder nur noch das Online-Schreiben? Das digitale Werk zerstört die Grenze zwischen dem Objekt Buch und dem Lesevorgang, jedes brouillon ist ein Appell an den Leser.
Facebook, Website, Twitter und das Blog, Timeline, jeder schreibt „sans constitution symbolique de l’écrivain“ (S. 261) Gar nicht sicher, dass die Schriftsteller dabei viel verlieren werden. Die digitale Welt verändert die Art und Weise, wie wir die Welt perzipieren. Ob sie sich dadurch wirklich auch verändert, darf man sich auch weiterhin fragen.
Stimmt das alles? Es ist zumindest etwas dran. Seine riesige Bibliothek, die Bon in allen Einzelheiten beschreibt, wie Un Voyage autour de ma chambre zugleich mit seiner Vorliebe, auf Lesetabletts aller Art zu lesen, zeigt, wie er sich trotz seiner enormen Bücherstapel zu Hause von der digitalen Welt beeindrucken lässt. Und der Literaturstudent von heute? Was hat er vom Internet zugunsten seiner Seminararbeit? Zeitgewinn oder eher mehr Zeitverlust?
Heiner Wittmann
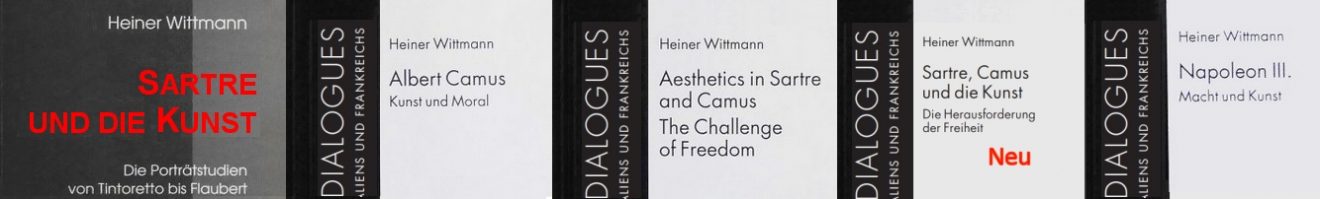
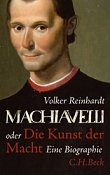
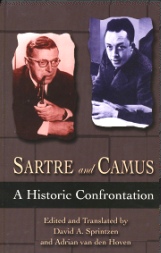
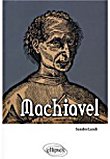
 Thomas R. Flynn, Existenzialismus. Eine kurze Einführung. Aus dem Amerikanischen von Erik M. Vogt. (Engl. Existentialism. A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York 2006), Wien, Berlin:
Thomas R. Flynn, Existenzialismus. Eine kurze Einführung. Aus dem Amerikanischen von Erik M. Vogt. (Engl. Existentialism. A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York 2006), Wien, Berlin:  Khalid Hadji,
Khalid Hadji, Hans-Martin Schönherr-Mann,
Hans-Martin Schönherr-Mann, Dirk Hoeges,
Dirk Hoeges, Zweimal behandelt Machiavelli das Thema eines neues Herrschertyps, der sich in Italien am Beginn der modellhaft zeigt: in „Der Fürst“ und in der Novelle „Das Leben des Castruccio Castracani aus Luca. Dirk Hoeges hat die großartige Novelle neu übersetzt und mit einem Essay herausgegeben, der ein neues Machiavelli-Bild entwirft.
Zweimal behandelt Machiavelli das Thema eines neues Herrschertyps, der sich in Italien am Beginn der modellhaft zeigt: in „Der Fürst“ und in der Novelle „Das Leben des Castruccio Castracani aus Luca. Dirk Hoeges hat die großartige Novelle neu übersetzt und mit einem Essay herausgegeben, der ein neues Machiavelli-Bild entwirft.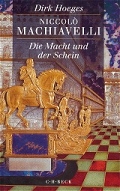 Die Geschichte Machiavellis ist die Geschichte seiner Entstellung und Ausbeutung. Sie resultiert aus einer reduzierten Deutung des „Principe“, welche die Komplexität des Humanisten verkennt. Dirk Hoeges entwirft ein neues Bild des Autors, das ihn als bedeutenden Schriftsteller der Renaissance würdigt und zugleich seine erstaunliche Modernität zeigt.
Die Geschichte Machiavellis ist die Geschichte seiner Entstellung und Ausbeutung. Sie resultiert aus einer reduzierten Deutung des „Principe“, welche die Komplexität des Humanisten verkennt. Dirk Hoeges entwirft ein neues Bild des Autors, das ihn als bedeutenden Schriftsteller der Renaissance würdigt und zugleich seine erstaunliche Modernität zeigt.