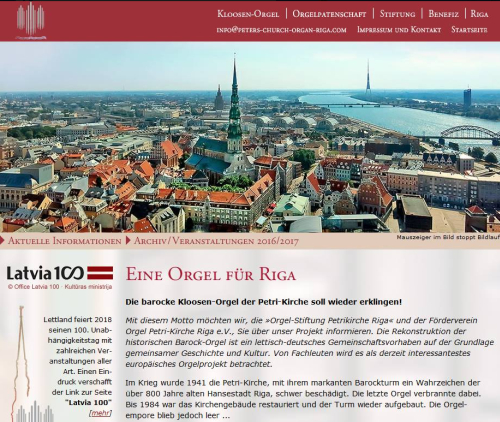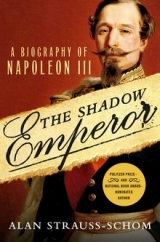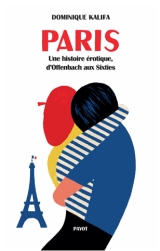Rezension: Michiko Kakutani, Der Tod der Wahrheit
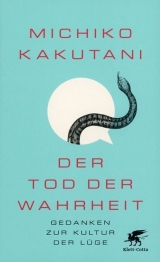 Die amerikanische Literaturkritikerin Michiko Kakutani hat in ihrem Buch – in der Übersetzung von Sebastian Vogel – > Der Tod der Wahrheit sich Gedanken zur Kultur der Lüge gemacht. Der Originaltitel ihres Buches lautet The Death of Truth. Notes on Falsehood in the Age of Trump. Sie hat dabei die Auswirkungen der sogenannten sozialen Medien im Blick, aber sie konzentriert sich auf die Bedingungen, die dazugeführt haben, dass die Wahrheit in diesem neuen postfaktischen Zeitalter an Bedeutung verloren hat.
Die amerikanische Literaturkritikerin Michiko Kakutani hat in ihrem Buch – in der Übersetzung von Sebastian Vogel – > Der Tod der Wahrheit sich Gedanken zur Kultur der Lüge gemacht. Der Originaltitel ihres Buches lautet The Death of Truth. Notes on Falsehood in the Age of Trump. Sie hat dabei die Auswirkungen der sogenannten sozialen Medien im Blick, aber sie konzentriert sich auf die Bedingungen, die dazugeführt haben, dass die Wahrheit in diesem neuen postfaktischen Zeitalter an Bedeutung verloren hat.
Sie erinnert an Hannah Arendt, die 1951 in Elemente und Ursprünge der totalitären Herrschaft ein Bild vom idealen Untertan einer totalitären Herrschaft gezeichnet hat, für den die Unterschiede zwischen Wahr und Falsch verwischt und verlorengegangen sind. Damit ist der Ton dieses Buches angeschlagen. Es geht nicht mehr nur um eine Tendenz, denn das was russische Trollfabriken uns per Internet ins Haus schicken, ist schon längst eine reale Bedrohung unser Demokratien geworden: vgl. > Nachgefragt: Michal Hvorecky, Troll – Website von Klett-Cotta, 18. Oktober 2018.
Die Menschen sind aufgrund vielerlei Ängste vor gesellschaftlichen Veränderungen, dem Hass auf alles Fremde und dem Verlust des Gefühls für eine gemeinsame Realität, also alle Bedrohungen, die durch Populisten geschürt werden, für Fake News jeder Art empfänglich geworden. Tatsachen werden in den Sozialen Medien, die sich gerne als von der Weisheit der Massen gesteuert geben, verdreht, verkürzt und geleugnet, wobei die Vernunft auf der Strecke bleibt. „Alternative Fakten“ führen zu einem rapiden „Zerfall der Wahrheit“, für den Kakutani vor allem Donald Trump für verantwortlich hält. Unter ihm werden Fachkenntnisse durch falsche Behauptungen ersetzt, so dass man den Verfall des öffentlichen Diskurses längst im Gange ist:
Zur Erinnerung: „Richard Sennett hat 1977, ohne dass es soziale Netzwerke gab, schon über sie geschrieben: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität (S. Fischer, Frankfurt/M. 1983). Der Originaltitel The Fall of Public Man ist viel treffender für seine Thesen. In Anlehnung an sie kann man sagen, dass die sozialen Netzwerke keinesfalls sozial sind, sondern zum Niedergang der Öffentlichkeit gerade durch die Vorspiegelung der Öffentlichkeit erheblich und entscheidend beitragen. Je mehr gemeinsame Identität festgestellt oder entwickelt wird, je gleicher alle werden, so möchte man hinzufügen, so unmöglicher wird die Verfolgung gemeinsamer Interessen, erklärt Sennett (dt. S. 295). Das ist nicht unbedingt so paradox, wie es klingt. Nur die Unterschiede lassen die Neugier entstehen und führen zum Entdecken von Neuem.“ > Wo führen uns soziale Netzwerke hin? oder Sind soziale Netzwerke wirklich sozial? – 29. Dezember 2008.
Michiko Kakutani identifiziert präzise die heutigen Bedingungen für die Nachrichtenerstellung: Nachrichten werden mit Unterhaltung gemischt und erhalten eine gehörige Dosis Polarisierung, ohne dass Journalisten eine ihrem Stand gemäße Einordnung vornehmen können, bevor die Weisheit der Massen sich schon der Verbreitung ungeprüfter Nachrichten gemäß ihrer Interpretation und ihrer Zwecke bemächtigt hat.
Polarisierung und Relativismus sind die Stichworte, mit der Kakutani den Niedergang des öffentlichen Diskurses beschreibt. Wahrheiten werden angezweifelt und überhaupt die Existenz „universeller Wahrheiten“ (S. 15) werden in Frage gestellt. Autoren wie François Lyotard mit seinem Grabmal für die Intellektuellen haben dazu erheblich beitragen, in dem z. B. Lyotard behauptete, es gebe keine universalen Erzählungen und folglich auch keine Intellektuellen mehr, eine Meinung, eine bloße Behauptung, so dahergesagt ohne jede Begründung aber gut geeignet, um eben jenem Relativismus, den Kakutani mit Recht beklagt, Vorschub zu leisten.
Während noch für Abraham Lincoln und die Verfassungsväter der Vereinigten Saaten die Aufklärung mit ihrer Vernunft, Freiheit, Fortschritt und religiöser Toleranz einschließlich des Systems der „checks and balances“ das Leitmotiv war, stehen nun unter Trump ganz neue neue Narrative im Vordergrund, die die Vernunft durch Intoleranz ersetzen, im Vordergrund. „Rationalismus, Toleranz und Empirie“ (S. 25) werden unter Trump in Frage stellt und negiert und Falschinformationen und Unwahrheiten bestimmen das politische Geschäft. Diese Tendenzen werden durch den Niedergang der Ministerien in Washington verstärkt, die durch die Trump-Administration ausgehöhlt und deren Fachwissen missachtet wird.
Echtes Wissen wird durch die Weisheit der Massen ersetzt: Um den Gedanken fortzuführen: Früher gab es Berichte, Rapporte etc. heute regiert der Präsident per Tweets: „Unwissenheit und Intoleranz waren auf einmal modern.“ (S. 33).
Kapitel 2: Die neuen Kulturkämpfe. Die Populisten eignen sich nur zu gerne die Argumente der Postmodernisten mit ihrer Zurückweisung der Objektivität an und man kann zuschauen, wie sie sich ihre verqueren Interpretationen zurechtzimmern, in der die Klimafrage inexistent ist, wodurch der „dekonstrunktionistischen Geschichtsforschung“ (S. 53) Tür und Tor geöffnet wird. Ansichten wie mal hier Gehörtes werden zur Wahrheit erhoben. Das Pendel schlägt nach beiden Seiten aus: Fake News auf der einen seit, Wahrheit auf der anderen Seite, wobei wir es doch eigentlich mit Lessing (in Eine Duplik [gegen Goeze]) halten sollten: „Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: Wähle! ich fiele ihm mit Demut in seine Linke und sagte: Vater, gib! die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein!“ Die Negation wissenschaftlicher Erkenntnisse, das Missachten der Wissenschaften sind für Kakutani längst keine Tendenzen mehr, sondern harte Fakten.
Der Aufstieg der Subjektivität hat zur Abwertung der Wahrheit beigetragen. Fakten werde uninteressant, Trump setzt auf die Gefühle der Menschen und Kakutani warnt mit Blick auf Alexis de Tocqueville vor dem Entstehen eines wenn auch zunächst noch sanften Despotismus. (S. 62 f.). Diese Tendenzen zeigen sich auch in der Literatur, wo der Realismus zunehmend verdrängt wird, und durch Memoiren und subjektive Bloggerei ersetzt wird.
Kakutani nimmt vor allem die Politik Trumps gegenüber den Einwanderern in den Blick und zeigt, wie die systematische Verdrehung der Tatsachen, falsche Interpretationen der Statistiken und unwahre Behauptungen die Ängste der Wähler schüren, damit Trump seine Projekte durchsetzen kann. Und dann kommen die Empfehlungsalgorithmen der sozialen Netzwerke in den Blick, die längst ihre eigene Interpretation der Wirklichkeit erzeugen, die mehr mit Werbung und Erlös etwas zu tun als mit der Wahrheit. Was am meisten angeklickt wird, erhält die Autorität der Weisheit der Massen. Schon wird der falsch verstandenen Begriff von der Demokratisierung der Inhalte genannt und damit das ganze Dilemma offengelegt.
Vielleicht haben wir uns an die Herrschaft der Algorithmen allzu leichtfertig längst gewöhnt. Jedes Googeln unterwirft uns dem Diktat dieser Suchmaschine, weil sie die Suchergebnisse für uns ordnet und uns vorgaukelt, dass das Interessanteste, das Beste und das Richtige oben steht. Die Weisheit der Massen dirigiert auch Wikipedia. Wir gewöhnen uns daran, dass Autoren sich hinter ihren Pseudonymen verstecken und es sich anmaßen dürfen, unsere Einträge in Wikipedia zu korrigieren. In Lexika standen früher Verlage und Autoren für die Qualität der Einträge, heute nimmt die Masse für sich in Anspruch, dort die Wahrheit zu verbreiten. Das Internet will eine neue Gemeinschaft fördern und es favorisiert durch soziale Medien, die überhaupt nicht sozial sind, die Entstehung von Silos, die die Menschen voneinander abgrenzen: S. 103, S. 111 f. Es geht längst nicht mehr um die Wahrheit, sondern die Empfehlungsalgorithmen täuschen Relevanz vor und zerstören einen gemeinsamen Realitätssinn. Die Technologie wird ein „höchst explosiver Brandbeschleuniger“. Die Auswirkungen sind enorm: in der U-Bahn daddelt jede(r) gedankenverlorenen auf dem Display, nirgends ist mehr eine Zeitung zu sehen, hin und wieder hält jemand noch ein Buch in der Hand. Der von Kakutani aus gutem Grund beklagte Niedergang der Aufmerksamkeit ist so zu beobachten: Empfehlungsalgorithmen ordnen für uns die virtuelle Wirklichkeit, Nutzerdaten werden wichtiger als die Qualität der Informationen. Marshall McLuhan hatte Recht, das Medium > Lesebericht: McLuhan, Fiore, Das Medium ist die Massage – Website von Klett-Cotta, 17. Juni 2011: Sein erster Satz: „Das Medium oder der Prozess unserer Zeit – die elektronische Technologie verändert die Form und Struktur sozialer Beziehungsmuster und alle Aspekte unseres Privatlebens,“ war mehr als eine Feststellung, er warnte völlig zu Recht vor eine Vereinnahmung durch die Neuen Medien, ließ aber noch einen Begeisterung für die aktive Nutzung der Neuen Medien erkennen, die heute nur noch von wenigen Bloggern und denjenigen, die eigene Inhalte Im Netz beisteuern, ohne sie in die vorgeformten Krüge der sozialen Medien zu gießen, geteilt werden.
Kakutani stellt in ihrem Buch keineswegs nur Symptome vor, sondern sie analysiert die Entstehung und die Wirkungen der Fake News und stützt sich dabei auf eine große Zahl von Fachleuten und Ergebnissen aus den Medienwissenschaften mit denen sie die Mechanismen entlarvt, mit denen die Wahrheit verdreht, relativiert und negiert wird. Ihr Buch ist ein Aufruf an uns alle, den sozialen Medien mit ihren Vorspiegelungen, uns die Wahrheit frei Haus oder Smartphone zu liefern, gründlichst zu misstrauen.
Michiko Kakutani
Der Tod der Wahrheit
Gedanken zur Kultur der Lüge
aus dem Amerikanischen von Sebastian Vogel
(Orig.: The Death of Truth. Notes on Falsehood in the Age of Trump)
Stuttgart: Klett-Cotta, 1. Aufl. 2019, ca. 200 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-608-96403-5 vergriffen
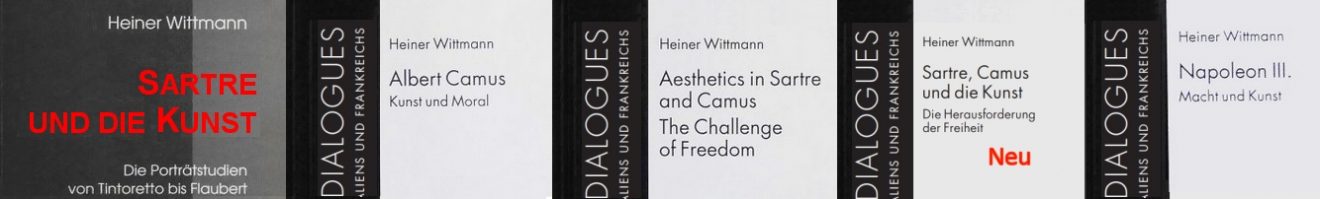





 Di
Di e beiden Bänden von Éric Anceau über
e beiden Bänden von Éric Anceau über 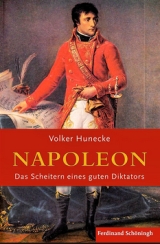 Der Untertitel „Das Scheitern eines guten Diktators“ der Biographie über Napoleon von Volker Hunecke, die 2011 im Verlag Ferdinand Schöningh erschienen ist, fasst die Thesen des Autors prägnant zusammen. Hunecke hat zuerst die Erfolge Napoleons im Auge: Der Erste Konsul hat in knapp drei Jahren Frankreich befriedet, für die Aussöhnung mit der römischen Kirche gesorgt, die Emigranten zurückgeholt, die staatliche Institutionen neu geordnet und neue Gesetzbücher verabschieden lassen. (vgl. S. 10) Folglich wurde er 1802 Konsul auf Lebenszeit. An dieser Stelle verortet Hunecke den Ursprung aller Probleme, die Napoleon von nun an begleiten werden. Seine Fehler, denen Hunecke sich im Lauf seiner Untersuchung zuwenden wird, seien nur der Tatsache geschuldet, dass Napoleon sich zum unumschränkten Herrscher habe aufschwingen können. (vgl. S. 12)
Der Untertitel „Das Scheitern eines guten Diktators“ der Biographie über Napoleon von Volker Hunecke, die 2011 im Verlag Ferdinand Schöningh erschienen ist, fasst die Thesen des Autors prägnant zusammen. Hunecke hat zuerst die Erfolge Napoleons im Auge: Der Erste Konsul hat in knapp drei Jahren Frankreich befriedet, für die Aussöhnung mit der römischen Kirche gesorgt, die Emigranten zurückgeholt, die staatliche Institutionen neu geordnet und neue Gesetzbücher verabschieden lassen. (vgl. S. 10) Folglich wurde er 1802 Konsul auf Lebenszeit. An dieser Stelle verortet Hunecke den Ursprung aller Probleme, die Napoleon von nun an begleiten werden. Seine Fehler, denen Hunecke sich im Lauf seiner Untersuchung zuwenden wird, seien nur der Tatsache geschuldet, dass Napoleon sich zum unumschränkten Herrscher habe aufschwingen können. (vgl. S. 12)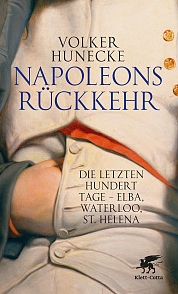
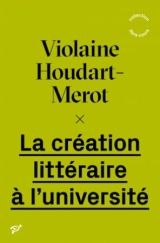 Kann man das Schreiben von literarischen Texten lehren und lernen? In ihrem jüngst erschienenen Band
Kann man das Schreiben von literarischen Texten lehren und lernen? In ihrem jüngst erschienenen Band