André Guigot: Eine Einführung in Sartres Philosophie

André Guigot, Sartre. Liberté et histoire,
Paris 2007, ![]() Librairie philosophie J. Vrin,. ISBN 978-27116-1913-9
Librairie philosophie J. Vrin,. ISBN 978-27116-1913-9
Die von André Guigot verfaßte Studie ist keine einfache Einführung in Sartres Philosophie. Die vielen verschiedenen Themen setzen ein Vorwissen und auch eine gute Kenntnis der Werke Sartres voraus. Damit sei aber nur gesagt, daß Guigots Band dem eiligen Leser eher anspruchsvoll erscheinen mag. Läßt man sich aber auf seine Argumentation ein, dann vermittelt dieses Buch eine sehr präzise, interessante und lesenswerte Einführung in die Philosophie Sartres.
Für seine Darstellung hat André Guigot mit Recht einen chronologischen Aufbau gewählt, der die Entwicklung seines Werkes auf der Grundlage der deutschen Phänomenologie über die Kriegserfahrung hinaus mit seinem Bemühen, die Moral begrifflich zu fassen und seinem Engagement ein theoretisches Fundament zu geben, umfaßt. Gerne wird immer wieder von zwei Abschnitten seiner Entwicklung gesprochen, wobei seine Auseinandersetzung mit dem Marxismus oft als Kennzeichen seines Werkes nach 1950 zitiert wird. Sein Versuch, den Existentialismus mit dem Marxismus zu verbinden, war nicht von Erfolg gekrönt, und Guigot akzentuiert viel mehr das Engagement im Verständnis Sartres und seine Suche nach einer Intelligibilität menschlicher Verhaltensweisen, die sowohl durch eine Dialektik wie auch durch die Geschichte beeinflusst werden, die Sartre bis zur Flaubert-Studie geführt hat.
In fünf Kapiteln untersucht Guigot nacheinander Sartres Auseinandersetzung mit der Phänomenologie, dann die Entstehung seiner ersten Schriften über die Einbildungskraft L’imagination (1936) und L’imaginaire (1940) und deutet mit der Überschrift des 3. Kapitels „L’aboutissement inachevé de L’être et le néant„, das nicht mit einer Lösung, sondern mit Fragen zur Verantwortung endet, eine Kontinuität mit seinen fol-genden Arbeiten an, die im allgemeinen zu der des 2. Sartre gerechnet werden. Im Ka-pitel IV geht es um die Entwicklung von der Moral zur Geschichte, womit Guigot auch hier nebenbei – aber in zutreffender Weise – darauf hinweist, daß in der letzten Zeit zunehmend die Überlegungen zur Geschichte vermehrt in den Blick der Forschung geraten. Seine Anmerkungen zur Ästhetik in Qu’est-ce que la littérature? (1947), seine Réflexions sur la question juive (1946) wie auch die langen Kapitel in den Cahiers pour une morale ([entstanden um 1946)] aus dem Nachlass veröffentlicht: 1983) bieten dazu viele Ansätze. Das letzte Kapitel untersucht das Problem der Gewalt im Rahmen der Geschichte, ein Thema, das im Zuge einer Neubewertung der Critique de la raison dialectique wieder mehr in den Blick geraten dürfte. L’Idiot de la famille (1970/72), das umfangreiche Flaubert-Porträt, hätte vielleicht in diesem Band von Guigot eine größere Aufmerksamkeit verdient als lediglich in der Zusammenfassung behandelt zu werden. Andererseits verleiht Guigot dieser Studie als „prolongement herméneutique de la raison dialectique“ (S. 231, vgl. W., Sartre und die Kunst, Tübingen 1996, S. 107 ff.) mit wenigen Worten den Platz, der ihr in Sartres Werk zukommt.
Im Verlauf der Studie entwickelt Guigot die Bedeutung aller wichtigen Schlüsselbegriffe. Dabei fällt auf, daß er schon bezüglich der Einbildungskraft, vor allem bei der Analyse von L’imaginaire sachgerecht und zutreffend die engen Beziehungen zwischen dem Imaginären und der Freiheit herstellt. Auch hinsichtlich seiner Darstellung des Analogons werden Entwicklungslinien deutlich, die bis zur Flaubert-Studie reichen. Zunächst aber erinnert er daran, daß die Theorie der Emotionen und des Imaginären eine Grundlage der Ontologie in L’être et le néant bilden. Tatsächlich ist die Lektüre von L’imaginaire eine wichtige Vorbereitung zu seiner Untersuchung über die phänomenologische Ontologie. Am Ende des zweiten Kapitels bestätigt Guigot in Form eines Resümees, daß die Ablehnung des psychologischen Determinismus kein System begründen könne, denn um die menschliche Realität zu begreifen, werde etwas Grundlegenderes benötigt: Das ist die Ontologie, mit der die Theorie des Imaginären angewandt auf die Kunst aber weitgehend ergänzt um die Fragen der Geschichte wiederaufgenommen werde, so Guigot. Und er ergänzt diese Aussage mit dem Hinweis auf den Zusammenhang von L’être et le néant, Qu’est-ce que la littérature? und den Cahiers pour une morale. . Schließlich ist die Freiheit eine Tatsache, deren Verständnis die menschliche Realität aufdeckt. Es ist nicht einfach, den Kern der Sartreschen Philosophie so verkürzt zusammenzufassen, aber unbestreitbar ist es dem Autor hier gelungen, das Verständnis der Sartreschen Philosophie zu erleichtern.
Im folgenden Kapitel über L’être et le néant zeigt Guigot – um hier nur ein Beispiel zu nennen – bezüglich der Kontingenz wichtige Parallelen zu La Nausée (1938), wodurch wieder die Verbindungen zwischen Sartres literarischem und philosophischen Werk betont werden. Dieses dritte Kapitel seiner Untersuchung zeigt die Fragen, die in L’être et le néant nach dem Anderen, der Angst und der Verantwortung gestellt werden. Dieses Kapitel kann auch als eine Einführung in die Lektüre von Sartres philosophischem Hauptwerk gelesen werden. Durch die Art und Weise, wie Guigot auch die offenen Fragen erläutert, wird der Leser verstehen, wie auch L’être et le néant in die Kontinuität des Sartreschen Denkens eingebunden ist. Im vierten Kapitel geht es um die historische Dimension, deren Einführung Guigot anhand der Überlegungen zu seinem Manifest über die Literatur erläutert: „L’ouvrage critique de Qu’est-ce que la littérature? (1947) fait de la création le sens même de l’interrogation éthique et esthétique,“ (S. 135) heißt es bei Guigot, der auf diese Weise an die fundamentale Bedeutung der Ästhetik im Werk Sartres erinnert. Der Schriftsteller ist engagiert, es geht bei Sartre nicht darum, daß dieser sich engagieren kann. Er schreibt und deshalb trägt er dafür eine Verantwortung, woraus auch wieder eine moralische Pflicht (S. 137) entsteht. „Ecrire, c’est agir,“ (S. 166) lautet die kurze Zusammenfassung, die auf den Appell (S. 168) an die Freiheit hindeutet. Aber auch die Cahiers pour une morale bleiben unvollendet und erscheinen erst 1983 aus seinem Nachlaßt. Auch dieses Kapitel endet mit einer Bewertung der Unterschiede zwischen L’être et le néant und den Cahiers pour une morale. Es geht u.a. um das unaufhebbare Verhältnis zum Anderen, das durch Abhängigkeit und Verantwortung gleichermaßen geprägt ist. Eine Aktion ist immer durch die Zukunft, das ist wieder das Überschreiten einer Situation aber auch durch die fehlende Garantie für eine moralische Vorschrift geprägt. Eine solche Verkürzung wird dem Autor der Studie sicher nicht gerecht, aber die Lektüre seiner Studie fördert das Verständnis der Philosophie Sartre. Nicht die Brüche charakterisieren sie, sondern sein Bemühen, die menschliche Realität der Freiheit und ihrer Möglichkeiten zu analysieren, wodurch die Kontinuität in seinem Werk gekennzeichnet ist, gehört zu seinen Hauptinteresse.
Es ist die Verbindung zwischen Kunst, Philosophie und Literatur, die in den 30er Jahren mit L’imagination und L’imaginaire sowie dem Roman La nausée sein Anfangswerk geprägt hat. In seinem philosophischen Hauptwerken hat Sartre mit seinen Untersuchungen zur Ontologie, zur Moral und zur Geschichte seine Überlegungen systematisiert und schließlich in der Flaubert-Studie von neuem angewandt. Guigots Studie behandelt kein isoliertes Thema seiner Philosophie, sondern zeigt die Kunst als Ausgangspunkt seines Gesamtwerks, und sie gibt so zu verstehen, daß die Philosophie bei Sartre kein Selbstzweck ist, da sie ein ständiger Bezugspunkt jedes seiner anderen Werke ist, und daher auch nur im Gesamtzusammenhang seines Werkes unter Berücksichtigung seiner Schriften über die Kunst und die Literatur erläutert werden kann.
Heiner Wittmann
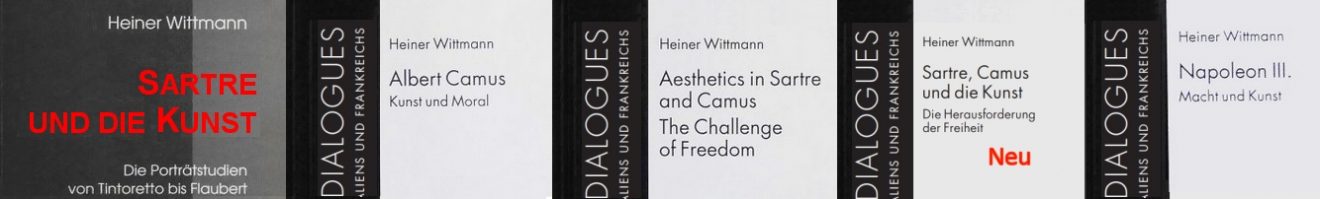


 Kleck, Véronique,
Kleck, Véronique,

 DOKUMENTE. Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog hat seinem 2. Heft / 2007 ein Dossier 50 Jahre Römische Verträge vorgelegt. Außerdem berichten mehrere Autoren über die bevorstehenden Wahlen in Frankreich.
DOKUMENTE. Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog hat seinem 2. Heft / 2007 ein Dossier 50 Jahre Römische Verträge vorgelegt. Außerdem berichten mehrere Autoren über die bevorstehenden Wahlen in Frankreich. Khalid Hadji,
Khalid Hadji, Hans-Martin Schönherr-Mann,
Hans-Martin Schönherr-Mann, Ronald Aronson, Camus & Sartre, Amitié et combat, übers. v. D. B. Roche, D. Letellier, Alvik Editions, Paris 2005. ISBN 2-914833-28-8
Ronald Aronson, Camus & Sartre, Amitié et combat, übers. v. D. B. Roche, D. Letellier, Alvik Editions, Paris 2005. ISBN 2-914833-28-8