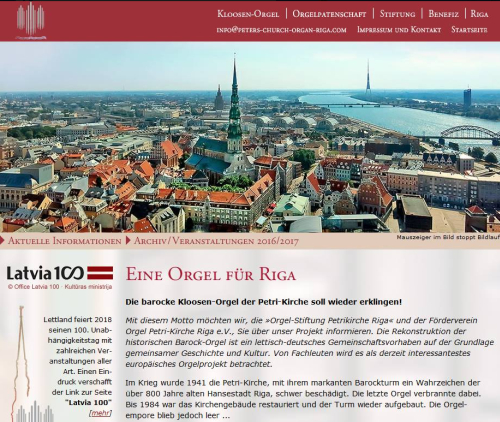Le Groupe d’Études Sartriennes (GES) lance son appel pour le colloque annuel qui se tiendra les 19 et 20 juin 2020 à Paris: En Sorbonne, amphithéâtre Milne Edwards, Paris IV, Niveau F.
L’objectif du GES, qui réunit chaque année une soixantaine de spécialistes de Sartre (universitaires ou non) est de soutenir le développement des perspectives nouvelles sur cette oeuvre majeure, de permettre aux enseignants et aux chercheurs de présenter leurs travaux en cours et de promouvoir les études sartriennes à un niveau national et international. Le GES propose aux enseignants et chercheurs débutants ou confirmés de soumettre une proposition de communication scientifique originale portant sur la pensée et les écrits de Sartre (littérature, philosophie, textes politiques), ou dont l’objet (auteur, question) est en relation directe avec ceux-ci.
Zum Herunterladen: > Argumentaire colloque GES 2020
> Groupe d’études sartriennes GES – > Sartre-Gesellschaft, Berlin
Pour l’édition 2020, le GES souhaite encourager deux séries de propositions de communication portant sur la question de l’esthétique sartrienne d’une part, et sur la trilogie Les Chemins de la liberté d’autre part.
Pour autant, ces deux thématiques sont bien des propositions et non des contraintes ; elles laissent ainsi toute latitude aux propositions les plus diverses afin de rendre compte de l’oeuvre de Sartre dans toutes ses dimensions (roman, théâtre, philosophie, essais sur la littérature, réflexion politique) ainsi que de la relation entre cette oeuvre et celle d’autres écrivains et philosophes.
1. Esthétique(s) de Sartre
Si Sartre n’a pas produit de théorie esthétique à proprement parler dans un ouvrage unifié, de très nombreux fragments de son oeuvre témoignent d’un intérêt profond et sans cesse renouvelé pour les questions esthétiques, au croisement de la littérature et des arts plastiques. On dispose de plusieurs ouvrages et articles sur la question, parmi lesquels on mentionnera notamment : Michel Sicard, Sartre et les arts, Obliques nº 24-25 (Nyons, Éditions Borderie, 1981), Heiner Wittman, L’esthétique de Sartre : artistes et intellectuels (Paris, L’Harmattan, 2003), Sophie Astier-Vezon, Sartre et la peinture. Pour une redéfinition de
l’analogon pictural (Paris, L’Harmattan, 2013). Pour autant, l’esthétique reste un champ encore assez peu exploré des études sartriennes. La proposition du Colloque vise à combler cette lacune, en posant la question : une ou plusieurs esthétique(s) chez Sartre ?
« Esthétiques » au pluriel, dans la mesure où l’objet lui-même est pluriel, partagé entre deux régimes esthétiques : les arts visuels (peinture, sculpture, cinéma, urbanisme) et la littérature, passibles de deux grilles d’intelligibilité différentes. Les descriptions sartriennes d’oeuvres visuelles prennent place dans une théorie générale de l’image comme type de conscience intentionnelle. La conclusion de L’Imaginaire (Paris, Gallimard, 1940) esquisse les linéaments d’une phénoménologie de l’objet esthétique comme irréel, qui sera mise en oeuvre par la suite sur des figures précises d’artistes, reprises dans les volumes III, IV et IX des Situations : Tintoret, Giacometti, Calder, Masson, Rebeyrolle, Wols, Lapoujade. La littérature quant à elle est envisagée et valorisée sous l’angle moral et politique comme engagement et praxis de dévoilement (Qu’est-ce que ma littérature ?, 1947), au moyen de « mots chargés comme des pistolets », à rebours de toute attitude de survol.
Un premier axe de ce volet du Colloque consistera alors à se demander s’il existe une unité de l’esthétique sartrienne. La littérature-praxis telle que l’envisage Sartre dans les années 1940 n’est-elle pas un refus de l’esthétisation du réel, tombant du même coup en dehors du domaine de l’esthétique, confiné à l’irréel ? Le modèle sartrien de l’engagement de l’écrivain ne conduit-il pas à dévoyer le champ de l’esthétique ?
En effet, ni le fait pictural, ni le fait littéraire ne semblent envisagés dans leur autonomie proprement esthétique, puisqu’ils renvoient à des modes d’intelligibilité plus larges : la conscience imageante et irréalisante d’une part, la praxis engagée et située d’autre part. Dès lors, l’esthétique sartrienne ne court-elle pas le risque d’être deux fois dissoute par chacun des deux modèles, l’image et la praxis ? Ou au contraire, ces deux grilles d’intelligibilité ne sont-elles pas l’occasion d’une reformulation et d’un enrichissement de la question esthétique, et de son autonomie éventuelle ? D’où la question également de la place de Sartre au sein du modernisme esthétique : en ouvrant le fait esthétique sur ses dehors – le monde des images au sens lare, le monde socio-historique de la praxis – Sartre ne tord-il pas le cou à l’exigence princeps du modernisme consacrant l’autonomie du médium artistique ? À travers cette question, s’ouvre la possibilité d’actualiser l’esthétique sartrienne en la faisant dialoguer avec des courants postérieurs au modernisme : par exemple, les Visual Studies, à travers les travaux de W. J. T. Mitchell, ou les réflexions de Fredric Jameson sur le postmodernisme.
Un deuxième axe de réflexion, dans le droit fil du premier, consistera à se demander dans quelle mesure l’épreuve du marxisme à partir des années 1950 ne vient-elle pas effriter la dichotomie instaurée par Sartre entre les deux modèles de l’engagement et de l’imaginaire, relançant à nouveaux frais la question d’une cohérence de l’esthétique sartrienne : dans quelle mesure le matérialisme historique est-il à même de fournir cette cohérence ? La question est ainsi ouverte de savoir quelle place occupe l’esthétique de Sartre au sein du « marxisme occidental » qui, depuis Lukács, met l’esthétique au coeur de ses préoccupations. La discussion entre Sartre et ses interlocuteurs de L’Institut Gramsci qui suit sa conférence de 1961, « Marxisme et subjectivité », peut notamment constituer un fil conducteur à cette question (cf. J.-P. Sartre, Qu’est-ce que la subjectivité ?, Paris, Les Prairies Ordinaires, 2013).
Quel rôle l’esthétique sartrienne accorde-t-elle par ailleurs aux « disciplines auxiliaires » (sociologie, histoire, anthropologie, psychanalyse, etc.) convoquées dans Questions de méthode ? On pourra se demander ainsi quelles sont les spécificités herméneutiques de la méthode progressive-régressive, dès lors qu’il s’agit de ressaisir une vie d’écrivain (Flaubert) ou de peintre (Tintoret), aux prises avec leur époque respective. Plus précisément, ce deuxième axe de réflexion fera la part belle à L’Idiot de la famille, dans la mesure où la praxis d’écrivain de Flaubert est ressaisie au prisme de l’imaginaire collectif de toute une classe, de toute une époque. Dans la mesure également où Sartre propose une redéfinition de l’oeuvre d’art au sens large comme « centre permanent, réel et reconnu d’irréalisation » (L’Idiot de la famille, t. I. Paris, Gallimard, 1971, p. 786), Sartre fait ainsi droit à la matérialité pratico-inerte de l’oeuvre en tant que produit social et marchandise, cette matérialité constituant le support des actes d’irréalisation que le créateur, comme le spectateur, accomplissent à l’endroit de l’oeuvre. Une telle redéfinition matérialiste de l’oeuvre constitue-t-elle un fil conducteur pertinent à l’esthétique sartrienne, soucieuse d’éviter le
piège de l’esthétisation du réel ?
2. Les Chemins de la liberté
Soixante-quinze ans après la parution du premier de ses trois volumes, L’Age de raison, le cycle romanesque des Chemins de la liberté apparaît trop souvent comme le mal-aimé de l’oeuvre littéraire de Sartre et comme le parent pauvre des études sartriennes, loin derrière l’intérêt suscité par La Nausée ou encore Les Mots. Il semble donc pertinent de se pencher de nouveau sur une oeuvre majeure, à la fois pour s’interroger sur ce statut négatif, afin de le comprendre et de le dépasser, et pour rendre toute sa place à un projet romanesque d’ampleur, le plus ambitieux de cette oeuvre, et que Sartre avait en tête dès le début des années trente lorsqu’il échafaudait son programme littéraire : d’abord le « factum » sur la contingence – ce serait La Nausée, paru en 1938 -, puis les nouvelles – Le Mur, paru en 1939, et enfin ce que Sartre a toujours désigné comme « le roman ».
S’il est ainsi intéressant d’observer que Les Chemins de la liberté relève de la volonté clairement affichée de se saisir de toutes les possibilités du genre romanesque en créant une véritable fresque nourrie de personnages multiples, cette ambition doit être mise en relation avec l’inachèvement du cycle et, plus encore, le fait qu’il marque la fin de l’écriture romanesque chez Sartre. Il sera donc fécond de s’interroger non seulement sur la relation entre cette oeuvre et la critique littéraire poursuivie par Sartre à la même époque, particulièrement sa réflexion sur l’art et les techniques romanesques (les articles réunis dans Situations I., notamment les textes sur Mauriac, Camus, Faulkner, Dos Passos…) mais également sur le lien entre les innovations formelles mises en oeuvre dans les trois romans et les réflexions déjà présentes dans les Conférences du Havre sur le roman données par Sartre durant l’hiver 1932-1933 et publiées en 2012 par la revue Études sartriennes.
De même, s’agissant d’une oeuvre rédigée durant les années charnières qui voient Sartre écrire certaines de ses oeuvres les plus marquantes, tous genres confondus (des Carnets de la drôle de guerre à L’Être et le néant en passant par Huis clos et Les Mouches), il sera possible de reprendre la question maintes fois posée de la relation, chez Sartre, entre les idées et la fiction, le roman et la philosophie, mais aussi de considérer l’influence de l’écriture théâtrale sur l’écriture romanesque. Enfin, parce qu’elle rend compte d’une réflexion nouvelle sur l’Histoire et la dimension collective de la liberté, parce qu’elle s’écrit – et s’inscrit – durant les années cruciales qui vont de la drôle de guerre aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale (le troisième volume, Le Sursis, est publié en
1949, peu de temps après l’interruption de l’écriture des Cahiers pour une morale), cette oeuvre occupe, à l’évidence, une place elle-même centrale, et qu’il importe de mieux définir, dans l’évolution philosophique, morale et politique de Sartre.
________________________________________________________________________________
Les communications, généralement présentées en français, peuvent également l’être en anglais. Dans ce cas, il sera demandé à l’orateur de fournir, à l’avance, un résumé en français à destination des auditeurs du colloque. Les propositions de communication, qui doivent comporter un titre et un résumé en un paragraphe, sont à faire parvenir aux secrétaires du GES pour le 10 février 2020. Les communications ne devront pas excéder 30 minutes.
Prière de faire parvenir vos propositions de communication aux deux secrétaires, en les adressant à l’adresse électronique personnelle de chacun d’eux, et non à l’adresse du GES.
Président du GES :
Michel Contat > contat.michel@wanadoo.fr
Secrétariat du GES :
Alexis Chabot > alexis.chabot@orange.fr
Hervé Oulc’hen > oulchenherve@gmail
 A cause de l’actualité, notre rédaction a récemment republié notre compte-rendu de La Peste d’Albert Camus, paru en 1947, Wiedergelesen: Albert Camus, Die Pest – 13 octobre 2020. Comme c’est une bonne habitude sur notre blog de faire suivre des comptes-rendus par une interview ou un autre entretien télévisé dans notre série “Nachgefragt…”, nous avons demandé au Professeur Lahkim Azelarabe Bennani (Université de Fès), s’il était prêt à participer à la première édition de notre soirée littéraire. Nous nous réjouissons, qu’il a accepté notre invitation :
A cause de l’actualité, notre rédaction a récemment republié notre compte-rendu de La Peste d’Albert Camus, paru en 1947, Wiedergelesen: Albert Camus, Die Pest – 13 octobre 2020. Comme c’est une bonne habitude sur notre blog de faire suivre des comptes-rendus par une interview ou un autre entretien télévisé dans notre série “Nachgefragt…”, nous avons demandé au Professeur Lahkim Azelarabe Bennani (Université de Fès), s’il était prêt à participer à la première édition de notre soirée littéraire. Nous nous réjouissons, qu’il a accepté notre invitation :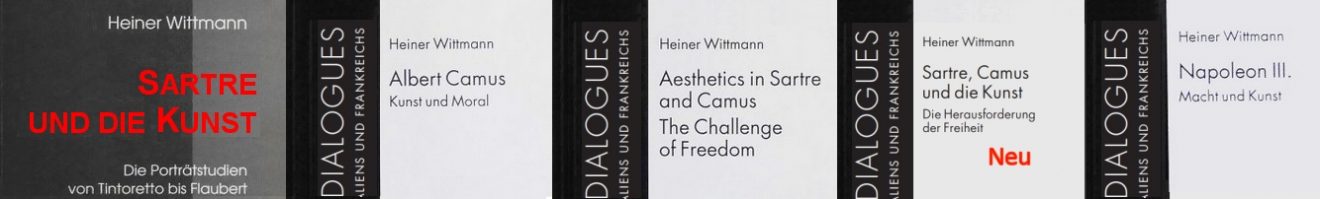
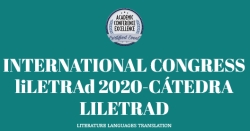
 r, Dichter und Herausgeber Jorge Luis Muñoz Navarro, das er auf diesem Kongress unser Buch vorstellt:
r, Dichter und Herausgeber Jorge Luis Muñoz Navarro, das er auf diesem Kongress unser Buch vorstellt: